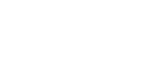Unter dem Titel "Echolot II. Die Liebe ist eine gefährliche Strömung" versammeln sich hier jüngste Semesterarbeiten, die sich das Wasser als Gestaltungs- und Inspirationsquelle zu eigen gemacht haben. Wasser hat bekanntlich mit Liebe zu tun, mit Werden und Vergehen, mit Tod und Wiedergeburt, mit Schicksal und Bekenntnis. Nichts ist reicher an Stoff, Qualität und Dramatik als die Liebe. Und so tauchen auch die ausgestellten Bilder den Betrachter in eine Welt aus Mystik, Chaos, Komik und zeichnerischer Ordnung. Die Bandbreite des Themas spiegelt sich in den unterschiedlichen Bilderfolgen wieder, denn der Studiengang Zeichnen hat vor allem mit dem Erzählen von abstrakten Zusammenhängen in Bildergeschichten zu tun. Wasser als Liebeselixier - einige dieser Bilder sollen hier vorgestellt werden.
Der ganz große Wurf ist der jungen Zeichnerin Miriam Poferl (Mischtechnik/Ohne Titel) gelungen. Das freskenähnliche Tapetenbild auf Karton ist eine Simultandarstellung des Lebens in Zeit und Raum auf einmal. Wie ein Längs- und Querschnitt durch das Leben, seinen Kosmos und die Zeit fügen sich die einzelnen Bilder wie Puzzelteile auf insgesamt 18 (20?) Tafeln an die Wand. Der Bilderzyklus spannt sich auf vom Meeresgrund als tiefstem Punkt (Schiffswrack), der Meerestiefe mit ihren mythologischen Meereswesen, unterschiedlichen Fischarten, Quallen, Meeresungeheuern, U-Booten, gefüllten Fischernetzen bis zur Meeresoberfläche mit den mit tobenden Wellen kämpfenden Schiffen, vielfältigen Wassergefährten bis zum Himmel mit allen nur erdenklichen Fluggeräten, mythologischen Luftwesen, Engeln, Göttern, Titanen, Regen- und Wetterwolken. Am höchsten Punkt thront Gottvater mit Sohn im Sonnenstuhl mit Sonnenschirm und blickt gelassen herab auf das Treiben. Die Grenzen der Welt sind ebenfalls ausgelotet und liegen rechts und links von diesem Längsschnitt aufgeklappt. Rechts ist die Zivilisation erkennbar mit Städten, Badenden, Autobahnen, Industrie, Häfen und Kreuzfahrtschiff. Links verliert sich das Tapetenbild am Polarkreis mit Eis und Schnee und verlorenen Schiffbrüchigen auf einem Floß. Wäre die Welt in Raum und Zeit aufklappbar, würde sie wohl so aussehen. Trotz dieser riesigen Anlage des Bildes verblüffen die mit unendlicher Mühe und Sorgfalt gezeichneten Details, Miniaturen und Winzigkeiten, die in dieser großen Anlage des Bildes keineswegs verloren gehen. Tritt man nahe an die Wand heran, kann man sich in die unendliche Lebensfreude der Badenden am Strand versenken oder dem höchst kunstvoll gemalten Wellenspiel auf der Meeresoberfläche hingeben, die von den vom Himmel herunterlangenden Titanen spielerisch-tödlich aufgerührt werden. Für eine Semesterarbeit erstaunlich opulent, findet das Bild - Anklang an die berühmten Fresken des 15. Jahrhunderts in Italien und hier vor allem zu Michelangelo. Wie tief seine malerische Darstellung der reichhaltigen Götter-, Titanen- und Menschenwelten an den Decken der Basiliken, Kirchen und Villen des Cinquecento den ästhetischen Sinn, Geschmack bis in die Neuzeit prägen, lässt sich hier wunderbar nachvollziehen. Die Schöpferin erweist ihren Quellen Referenz.

Mischtechnik ohne Titel von Miriam Poferl
Eine weiterer beeindruckender Arbeitszyklus sind die wuchtigen, fast klotzigen Graphitbilder von Johannes Kiesselbach. Die mit Bleistift gezeichneten Flächen aus fließendem, fallenden Wasser, wasserbedeckten Körpern, überflossenen steinernen Architekturen wie Wasser¬fälle, durchflossenen Rohre, übergossenen Brunnen und schluchtartigen Häuserwände haben programmatischen Charakter. Es ist vor allem der breitflächige und raumgreifende, aber dennoch sehr plastische und ausdrucksstarke Zeichenstrich, der ins Auge fällt. Wasser wird hier zu einem Vorhang aus überstülpender Fläche, die wie Öl schwer und bleiern am Körper klebt, ihn verhüllt und vernichtet – von Wasserfreude kaum noch eine Spur. Wie ein Stoff oder festes Gewand kleidet es die Welt ein, wird Baustoff und Kunstfläche zugleich, in der der Mensch verschwindet. In diese seltsam toten Wasserwelten ist der weiße und unausgemalte Körper des herumwandelnden Menschen von gespenstischer Blässe und Fragilität, und nur der monumentale und buddhaähnliche Körper der sich mächtig aus dem Wasser stülpt, vermag diese bleierne Wasserwand zu durchstoßen (siehe Ausstellungsplakat). Aber diese Monumentalfigur hat nichts Menschliches mehr an sich und lässt deshalb jede Identifikation abprallen. Das entfremdete oder entmenschlichte Wasser tritt dem Betrachter als eine eigenständige, menschenfeindliche Kraft entgegen. Selbst der Arm, der mit dem herunter rinnenden Wasserstrom eine Achse bildet, kann diese Entfremdung nicht mehr aufhalten, denn die Stärke, die es braucht, um diesem Strom standzuhalten, ist außergewöhnlich - eben urtümlich und unmenschlich.

Arbeitszyklus von Johannes Kiesselbach
Seltsam und auch am Abgrund entlang erzählt scheinen die Arbeiten von Nele Palmtag (Bleistift, "Die Berührten"). Die Bildunterschrift sagt: Nach einer Volkserzählung aus Uruguay. Es ist eine Geschichte von Vereinigung, Verwandlung, Häutung, Fraß und Tod. Entmischung von Leib, Natur und Wasser hat nie stattgefunden und wird am Ende bestraft. Die Geburt dieses amphibischen Urvieches hat etwas alptraumhaftes, kafkaeskes. Es kann nur den Tod bedeuten, den es auch bringt und später als Demütigung oder Erlösung wiederum selber akzeptiert. Der Kreislauf des Lebens entwickelt sich hier ausschließlich über den Tod und über das Hässliche, über das Unbegreifbare oder Ungreifbare. Die Bilderfolgen haben selber etwas seltsam „Berührtes“ und stigmatisieren die Welt, indem sie den Bodenbelag des Alltäglichen anheben und einen Blick dahinter riskieren. Gelohnt hat es sich allemal.

"Die Berührten" von Nele Palmtag
Ein mythologisches Bild der tödlichen Verschlingung von Eros, Wasser und Tod ist die große Wandtafel von Maria Luisa Witte. Vielleicht ist es das einzige Bild, das bewusst bekannte Wassermythologien und -erzählungen zitiert. Gemeint sind die Geschichten von Undingen, Nymphen, Wasserfrauen, die immer (neben der Verführung) auch den Tod bedeuten. Das Bild liest sich im Kreis. Eine junge schöne Frau mit aufgestecktem Haarbeutel steigt in einen Seerosenteich und wird von zwei blauen Männerarmen in die Tiefe gezogen. Dabei ist die gemalte Perspektive eine untersichtige, und der Zuschauer so immer gleichsam unter Wasser, so dass er das Schicksal der Frau teilt. Das Mädchen gleitet in die Tiefe, kann aber durch gute Schwimmkünste wieder an die Oberfläche des Sees zurück, durchstößt das Wasser mit ihren vorgestreckten Händen und steigt Stück für Stück aus dem Wasser empor. Über ihr schweben zwar noch Wale oder andere große Fische (was die Perspektiven innen und außen verwirrt), aber sie scheint außerhalb des Wassers und damit gerettet zu sein. Ist diese Geschichte von Ein- und Aussteigen, von Tieftauchen und Emporkommen, von Tod und Erlösung im Wasser dunkel im Hintergrund des Bildes erzählt, erstrahlt der tödliche Moment der Umarmung und des Herabziehens in hellem blendendem Weiß und Blau. Die Frau wendet uns dabei ihr liebliches Profil und ihren verführerischen Rücken zu. So sind die herauflangenden, tödlich verschlungenen Arme um ihren Körper in gewisser Weise das Begehren selbst, das den Betrachter packt. Der Befreiungsakt ist dabei fast nebensächlich.

von Maria Luisa Witte
Wasserströmungen haben etwas Qual-, aber auch etwas Genussvolles. Zwei Bilder mit gleichem Inhalt zeigen dies. Die Frau in der Badewanne von Susanne Mewing schließt genüsslich die Augen und versenkt sich in das Wasserelement. Der Wasserfluss bildet dabei auf ihrem liegenden Körper einen Art Landkarte, in dem einige Körperteile frei- und andere überflossen werden. Ein wunderbar inneres, inniges Bild. Genau anders herum stellt sich die Szene auf dem Bild von Nadine Thomas dar, hier wird die Frau in einen Wirbel hineingerissen und nach unten gezogen. Wasser ist hier nur mehr tödliche Strömung. Und darum geht es ja auch.

"Frau in der Badewanne" von Susanne Mewing

Bild von Nadine Thomas
Fotos von Claire Lenkova
Echolot II. Die Ausstellung geht noch bis zum 31. Januar 2005
Erotic Art Museum, Bernhard-Nocht-Straße 69, 20359 Hamburg
Öffnungszeiten des Museums:
So-Fr: 10-24 Uhr;
Fr+Sa: 10-2 Uhr
Weitere Informationen:
http://people.freenet.de/Echolot/index.htm