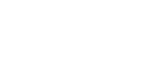Rückblick CCG Forschungskolloquium 2021 "Die Eindämmung von COVID-19 analysieren und modellieren"

Dr. Viola Priesemann
(Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen)
„Hätte, hätte, Infektionskette…“
Seit Beginn der COVID-19-Pandemie forscht Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen mit ihrem Team an Eindämmungsstrategien der Pandemie. Als Grundlage hierfür dienen Modelle, mit denen Ausbreitungsszenarien ansteckender Krankheiten beschrieben werden können. Diese Modelle müssen je nach Fragestellung angepasst werden, damit die relevanten Parameter in Betracht gezogen werden können, ohne dass die Rechnungen zu komplex werden. Dabei spielen die Effekte des Impffortschrittes, der Kontaktnachverfolgung oder die Implikationen von Fluchtvarianten des Virus und eine nachlassende Immunisierung eine Rolle. Am 10. November hat Dr. Viola Priesemann beim CCG Forschungskolloquium Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Wir haben ihre Kernthesen zusammengefasst:
Bei der Corona-Pandemie steuert Deutschland laut Dr. Viola Priesemann direkt auf die vierte Welle zu. Welche Stellschrauben müssten jetzt gedreht werden, um die weitere Ausbreitung zu stoppen? „Wir haben bereits beim ersten Ausbruch von COVID-19 in Deutschland im Frühjahr 2020 anhand von Modellrechnungen zeigen können, dass stärkere Maßnahmen, wie Kontaktverbote zu sehr deutlichem und schnellen Rückgang der Reproduktionszahl R führen“, so Dr. Viola Priesemann. „Aber wie effektiv Maßnahmen wirklich sind, hängt extrem davon ab, wie sorgfältig sie auch durchgeführt werden.“ Wenn Menschen also beispielsweise die medizinische Maske eher als Kinnschutz trügen oder eine Quarantäne nicht einhalten wollten oder könnten, verbreite sich das Virus trotz strenger Maßnahmen weiter.
Eine der größten Herausforderungen bei der Eindämmung der Pandemie sieht die Wissenschaftlerin in den unentdeckten Infektionsherden: „Wir können uns das gut als Eisberg vorstellen: Wir haben die bekannten infizierten Personen, die regelmäßig Tests gemacht haben und dank guter Kontaktnachverfolgung über eine Infektion informieren können. Das ist der sichtbare Teil des Eisberges. Es gibt aber auch Menschen, die sich nicht testen, die sich trotz Infektion nicht isolieren und bei denen einzelne Kontakte nicht mehr nachvollzogen werden können. Diese unentdeckten Fälle, also der Teil des Eisberges, der unter Wasser ist, tragen besonders zur Ausbreitung der Pandemie bei.“
Dennoch sieht Dr. Viola Priesemann einen Grund für die relativ moderaten Fallzahlen in Deutschland darin, dass die Maßnahmen meist durchdacht und von den meisten strikt umgesetzt wurden und werden. Zudem gebe es ein sehr hohes Vertrauen in die Wissenschaft. „Die Pandemie hat uns auch gezeigt, dass wir eine starke Grundlagenforschung in Deutschland brauchen. Wir werden immer wieder mit Krisen konfrontiert werden. Daher müssen wir sie erforschen, um mit ihnen umgehen zu können.“
Und welche Eindämmungsmaßnahme hält die Wissenschaftlerin in der aktuellen Entwicklung der Pandemie für am effektivsten: „Wir müssen die Booster-Impfungen vorantreiben – die Zahlen aus Israel zeigen, dass dadurch die Infektionen deutlich zurückgegangen sind. Allerdings müssten wir in Deutschland rund 10-15 Prozent der Bevölkerung pro Woche boostern. Momentan liegen wir bei rund einem Prozent“, so Dr. Viola Priesemann.
Dr. Viola Priesemann absolvierte ihr Studium der Physik an der Technischen Universität in Darmstadt und erlangte 2013 die Promotion an der Goethe Universität in Frankfurt. Von 2014 bis 2016 ist Dr. Priesemann Bernstein Fellow und Gruppenleiterin am Bernstein Center for Computational Neuroscience & Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Seit 2016 leitet sie die Forschungsgruppe "Theorie neuronaler Systeme" am Max-Planck-Institut. Sie forscht seit Jahren zu Ausbreitungsprozessen aller Art, unter anderem von Krankheiten.
Weitere Informationen zu der Arbeit von Dr. Viola Priesemann und Informationen des RKI zur Pandemie:
https://www.viola-priesemann.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenberichte_Tab.html

14. April 2021 – 16:30 - 18:00 Uhr
Qualitätssicherung eines RCT am Beispiel der klinischen Studie „Be-Up: Geburt aktiv“
Dr. Gertrud M. Ayerle
(Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft)
Die klinische Studie „Be-Up: Geburt aktiv“ hat zum Ziel, die Wirksamkeit der Intervention "alternativ ausgestatteter Gebärraum" auf den Geburtsmodus (vaginale Geburt) zu prüfen.
Bereits in der Planung eines Forschungsvorhabens spielen Maßnahmen zur Sicherstellung einer optimalen Qualität der Datenerhebung und Studiendurchführung sowie zur Sicherheit der Studienteilnehmerinnen eine wichtige Rolle. Zentrale Qualitätskriterien nach ICH-GCP und deren konkrete Umsetzung werden am Beispiel der klinischen Studie „Be-Up: Geburt aktiv“ illustriert.
Ohne die Beachtung der Grundsätze nach ICH-GCP und der Planung von konkreten Maßnahmen zur Umsetzung dieser Qualitätskriterien haben Forschungsanträge für klinische Studien wenig Aussicht auf Förderung.
Dr. Gertrud M. Ayerle ist Hebamme und seit 2004 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Lehre und Forschung tätig. 2009 schloss sie ihre Promotion zum „Wohlbefinden in der Schwangerschaft“ ab. Seither leitet sie den Forschungsschwerpunkt „Gesundheitliche Versorgung durch Hebammen und Familienhebammen“ am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie hat reichliche Erfahrung in der Umsetzung von Forschungsprojekten, u.a. zu Forschungsthemen in der Hebammenwissenschaft (http://www.medizin.uni-halle.de/hebammenversorgung) und in der multizentrischen prospektiven randomisiert-kontrollierten Studie „Be-Up: Geburt aktiv“ (www. be-up-studie.de).
Gertrud M. Ayerle war mehrere Jahre in einem Basisgesundheitsprojekt in Nairobi, Kenia, tätig, bevor sie ihr Bachelor- und Masterstudium in Washington (DC) absolvierte. Von 2008-2018 war sie im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft e.V. tätig.
12. Mai 2021 – 16:30 - 18:00 Uhr
Programmänderung:
Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise – Gesundheitsberufe als Akteure der großen Transformation
PD Dr. med. Christian Schulz
(Geschäftsführung und inhaltliche Leitung KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V.)
Kurzvortrag zu Health for Future Hamburg
Julia Faul und Laura Schwieren (Health for Future, Ortsgruppe Hamburg)
urprünglich angekündigt:
Medizinischer Notfall Klimakrise - Lancet Countdown on Health and Climate Change als Enabler für die Mobilisierung in Deutschland
Dr. med. Martin Herrmann
(Vorsitzender KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V.)

Die Klimakrise ist eine existentielle Bedrohung für unsere Zivilisation und schon jetzt ein medizinischer Notfall. Sie hat bis vor kurzem im deutschen Gesundheitssektor keine Rolle gespielt. Das hat sich dank Fridays for Future und Health for Future grundlegend geändert. Die Ärztekammern, viele Fachgesellschaften, der Pflegerat, die Wohlfahrtsverbände und inzwischen über 60 Health for Future Gruppen haben das Thema als Priorität gesetzt. „The Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change“ ist Ergebnis einer weltweiten Forschungskooperation von 35 akademischen Institutionen. Der „Countdown“ berichtet jährlich anhand von 41 Indikatoren über die Wirkungen des Klimas auf die Gesundheit und gibt Empfehlungen für Regierungen. 2019 ist es gelungen, in einer Kooperation zwischen dem Helmholtz-Zentrum, der Charité Berlin, dem PIK, der Hertie School of Governance, der Bundesärztekammer und dem Lancet Countdown einen ersten Policy-Brief für Deutschland zu entwickeln und vorzustellen. 2020 wurde der zweite Policy Brief für Deutschland veröffentlicht. Damit besteht eine wissenschaftlich basierte Grundlage für Initiierung und Umsetzung umfassender Maßnahmen.
Der Initiator und Sprecher von KLUG begleitet seit vielen Jahren professionell Veränderungsprozesse. Ursprünglich Arzt und Psychotherapeut verlegte sich Martin Herrmann bald auf die Beratung von Unternehmen und NGOs, entwickelte neue Methoden zur Organisationsentwicklung und lehrt heute an internationalen Business Schools und Hochschulen. Seine besondere Liebe gilt der Komplexitätsforschung, der Philosophie und hier besonders Hannah Arendt.
Termine für das Wintersemester 2019/20:
| Mi, 9.10.2019, 16:30-18:00 Uhr, Campus Bergedorf, Ulmenliet 20, Raum 1.07 AB | Risikokompetenz als Voraussetzung informierter Gesundheitsentscheidungen | Christoph Wilhelm (Max-Planck-Zentrum für Bildungsforschung) |
| Mi, 13.11.2019, 16:30-18:00 Uhr, Campus Bergedorf, Ulmenliet 20, Raum 1.07 AB | Gesundheitsfolgenabschätzung als Kompass in der kommunalen Gesundheitsförderung Download (PDF) | Dr. Odile Mekel (Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen) |
| Mi, 11.12.2019, 16:30-18:00 Uhr, Campus Berliner Tor, Alexanderstraße 1, Raum 1.19 | Zur potenziellen Wirkung von Pflegepersonaluntergrenzen und anderer Instrumente der aktuellen Gesetzgebung | Prof. Dr. Jonas Schreyögg (Universität Hamburg) |