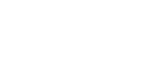Das Forschungsprojekt Nutr-e-Screen zielt darauf ab, ernährungsbezogene Gesundheitsrisiken im deutschen Leistungssport systematisch zu erfassen und die Ernährungsbetreuung von Athlet*innen durch die Digitalisierung und Standardisierung wissenschaftlich fundierter Instrumente zu verbessern.
Bisher erfolgt die Erfassung solcher Risiken, wie z. B. REDs (Relative Energy Deficiency in Sports) oder Essstörungen, nicht einheitlich und variiert stark je nach Sportverband oder Standort. Internationale Organisationen, wie das International Olympic Committee (IOC), fordern jedoch eine regelmäßige Erfassung von ernährungsbezogenen Gesundheitsparametern, da diese besonders bei Sportlerinnen international eine hohe Prävalenz aufweisen. Für Deutschland fehlen bislang sowohl belastbare Prävalenzdaten als auch detaillierte Informationen über spezifische Risikokonstellationen.
Ziel des Vorhabens ist es daher,
- bestehende, wissenschaftlich validierte, aber bislang analoge Instrumente der Ernährungsbetreuung im Leistungssport zu digitalisieren und diese standardisiert Akteur*innen im Sport zur Verfügung zu stellen,
- die digitalisierten Instrumente anhand ausgewählter Kriterien zu validieren und zusätzlich durch eine Machbarkeitsanalyse zu evaluieren sowie
- die erhobenen Daten aus den während der Projektlaufzeit teilnehmenden Athlet*innen standardisiert und differenziert nach Geschlecht und Sportart auszuwerten, um ernährungsbezogene Gesundheitsrisiken identifizieren zu können.
Das Vorhaben gliedert sich in zwei Studienarme:
- Digitalisierung und Evaluation eines Screenings auf ernährungsbezogene Gesundheits- und Leistungsrisiken (HAW Hamburg): Ein validierter Screeningbogen zur Erfassung ernährungsbezogener Gesundheitsrisiken wird digitalisiert und in mehreren kooperierenden sportmedizinischen Einrichtungen eingesetzt. Die erhobenen Daten werden über einen Zeitraum von 5–8 Monaten gesammelt, um eine geschlechter- und sportartspezifische Analyse von Prävalenzen und Risikokonstellationen zu ermöglichen.
- Entwicklung und Validierung eines Schätzprotokolls zur Erfassung der Lebensmittel-, Energie- und Nährstoffzufuhr (Universität Leipzig): Hier wird ein dreitägiges Schätzprotokoll zur Erfassung der Nährstoffzufuhr, analog und digital, auf seine Validität und Anwendbarkeit hin untersucht. Zusätzlich wird die Validität gängiger Aktivitätstracker zur Schätzung des täglichen Energieverbrauchs überprüft.
Das Projekt bezieht ca. 250 Athlet*innen aus verschiedenen Sportarten ein, wobei ein besonderer Fokus auf einer geschlechterdifferenzierenden Auswertung liegt. Etwa zwei Drittel der Teilnehmenden sollen weibliche Athleten sein, um spezifische Risikofaktoren, insbesondere bei bislang wenig untersuchten Gruppen, identifizieren zu können. Die zentralisierte Datenauswertung findet an der HAW Hamburg statt.
Zusätzlich werden qualitative Interviews mit Ernährungsberater*innen und Sportmediziner*innen durchgeführt, um die Praxistauglichkeit und Anwendbarkeit der digitalen Screening-Instrumente zu evaluieren und ggf. notwendige Anpassungen zu identifizieren.
Dieses Projekt wurde mit Forschungsmitteln des Bundesinstituts für Sportwissenschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert (Aktenzeichen: 070108/24-25).
Projektteam:
- Tim Hänisch
- Alicia Kaleta
- Fiona Erkens
- Janina Mai
Projektwebsite: https://www.bisp-surf.de/Record/PR020240300077
Projektflyer: Flyer zum Projekt Nutr-e-Screen (pdf)
Nutr-e-Bias
Sollte der Zyklusstatus von Athletinnen bei der Erhebung und Beurteilung ernährungsbezogener Gesundheitsitems in Zukunft berücksichtigt werden?
Untersuchung potenzieller zyklus-assoziierter Verzerrungen von Ernährungserhebungen bei Athletinnen.
Das Forschungsprojekt Nutr-e-Bias ist ein Aufstockungsprojekt des noch laufenden Forschungsprojekt Nutr-e-Screen und zielt darauf ab, systematisch zu überprüfen, ob und inwiefern der Zyklusstatus die Aussagekraft und Reproduzierbarkeit ernährungsbezogener Erhebungsinstrumente beeinflusst.
Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass der Menstruationszyklus das Ernährungsverhalten, das Körpergewicht und die Körperzufriedenheit beeinflussen kann. Für Leistungssportlerinnen liegen hier jedoch noch keine Daten vor. Bislang ist zudem auch unklar, ob Erhebungsmethoden ernährungsbezogener Gesundheitsparameter oder deren Validität durch die unterschiedlichen hormonellen Phasen des Zyklus beeinflusst werden und dadurch zu Verzerrungen oder Fehleinschätzungen bei der Beurteilung ernährungsbezogener Gesundheitsrisiken durch Fachpersonal führen können. Derzeit werden Ernährungserhebungen weder in der Allgemeinbevölkerung noch bei Athletinnen zyklusstandardisiert durchgeführt, obwohl hormonelle Schwankungen das Essverhalten und den Energiebedarf verändern können.
Ziel des Vorhabens ist es daher,
1. zu untersuchen, ob unterschiedliche hormonelle Situationen im Verlauf des
Menstruationszyklus die Ergebnisse und Aussagekraft der im Nutr-e-Screen
Projekt bereits digitalisierten und validierten Ernährungsinstrumente
(Screeningbögen, Verzehrprotokolle) und weiterer international etablierter Screeningmethoden (LEAF-Fragebogen, EDE-Q) beeinflussen
2. zu überprüfen, ob der Menstruationszyklus zu verzerrten, falsch-positiven oder falsch-negativen Beurteilungen durch Fachpersonal führen kann
3. zu klären, ob eine Standardisierung der Ernährungserhebungen in Bezug auf den Zyklus notwendig ist
4. zur wissenschaftlichen Fundierung und Optimierung zyklusadaptierter Erhebungsinstrumente sowie zur Reduzierung der gender data gap beizutragen
Im Rahmen des Forschungsprojekts werden die aus Nutr-e-Screen digitalisierten und validierten Ernährungsinstrumente in drei verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus (Menstruationsphase, Ovulationsphase, Lutealphase) über einen Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Monaten angewandt. Ergänzend zu den Ernährungserhebungen werden u.a. Hormonstatus und Körperzusammensetzung (mittels BIA-Messungen) erfasst.
Dieses Projekt wurde mit Forschungsmitteln des Bundesinstituts für Sportwissenschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
Der Projektarm Nutr-e-Bias wird in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig (Prof. Dr. Juliane Heydenreich) durchgeführt.