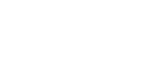„Durch die Bündelung unserer Kompetenzen im Energiebereich haben wir mit dem CC4E einen führenden Profilbereich der HAW Hamburg aufgebaut, der von Wirtschaft und Politik, aber auch von den anderen Hochschulen in der Metropolregion als wichtiger und kompetenter Partner wahrgenommen wird,“ sagt Werner Beba, Leiter des CC4E, und freut sich über die positive Entwicklung des Competence Centers.
Schaut man auf die letzten vier Jahre, ist die Idee des CC4E, der Ausbau und die Vernetzung der Kompetenzen im Bereich der Erneuerbaren Energien, aufgegangen. Neben vielen laufenden Forschungsprojekten zur Wind-, Solar- und Bioenergie, Netzintegration, Energiespeicherung, sowie zu Akzeptanzforschung und nachhaltiger Stadtentwicklung (eine Übersicht finden Sie im aktuellen Newsletter des CC4E www.haw-hamburg.de/index.php) bietet die HAW Hamburg mittlerweile vier Studiengänge für Erneuerbare Energien und vier weitere mit starkem Bezug zu Erneuerbaren Energien an. Die HAW Hamburg ist damit im deutschlandweiten Vergleich zu anderen Hochschulen weit vorn.
Energie-Campus Hamburg: Silicon Valley
für den Forschungs- und Wissenschaftsbereich Erneuerbare Energien
Mit dem Bau des Energie-Campus Hamburg, den das CC4E aktuell vorantreibt, erhält der Forschungs- und Wissenschaftsbereich Erneuerbare Energien jetzt ein innovatives Technologiezentrum. „Der Energie-Campus in Bergedorf wird Forschungs- und Ausbildungslabore für Windenergie und intelligente Stromnetze beherbergen. Mit diesem Technologiezentrum fügen sich viele Puzzleteile des CC4E zu einem großen Ganzen zusammen. Mit der räumlichen Vernetzung soll eine fach- und fakultätsübergreifende Zusammenarbeit in Forschung, Wissenschaft und Lehre geschaffen werden. Dies kann ein entscheidender Vorteil bei Innovationen für Erneuerbare Energien sein“, sagt Beba.
Drei besonders große Projekte gehen mit der Realisierung des Energie-Campus einher: Eine Akademie Erneuerbare Energien soll als Verbundprojekt mit Unternehmen der Metropolregion für eine weitere Verzahnung mit der Wirtschaft sorgen. Die Konzeptentwicklung wird von der Hamburger Wirtschaftsbehörde gefördert. Als Ausbildungsangebote sind hier in der Konzeption zwei berufsbegleitende Masterstudiengänge, „Wind Engineering“ und „Renewable Energy Management“, verbunden mit der Möglichkeit, Einzelmodule als Zertifikatskurse für die berufliche Weiterqualifizierung zu belegen.
„Bei allen technischen Neuerungen darf man natürlich nicht die Menschen und den gesellschaftlichen Dialog vergessen. Auch die Bürgerorientierung und das Fördern von Akzeptanz sind für uns wichtige Aspekte. Denn nur wer gut über neuen Technologien informiert ist, ihre Vor- und Nachteile kennt, ist bereit, diese auch zu akzeptieren,“ sagt der Leiter des CC4E zum zweiten großen Vorhaben, das am Energie-Campus realisiert werden soll. Ein Informations- bzw. „Faszinationszentrum“ soll entstehen, um Erneuerbare Energie für alle erlebbar und verständlich zu machen. In begleitenden Forschungsprojekten sollen Lösungen für Akzeptanzstrategien entwickelt werden.
Dass Bürgerorientierung und -akzeptanz ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Energiewende ist, bekommt das CC4E gerade selbst zu spüren. In fußläufiger Nähe zum Energie-Campus soll ein Forschungs-Windpark entstehen, der auch in Lernprojekten Studierenden unter anderem Erfahrungen in technischer und kaufmännischer Betriebsführung vermitteln soll. In anderen Stadtteilen Bergedorfs formieren sich Bürgerinitiativen gegen den dortigen Ausbau von Windenergie. Mit den Akteuren führt das CC4E einen Dialog.
Große Potentiale für wachsende Kompetenzen und Reputationsgewinn der HAW Hamburg bietet die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie in Itzehoe (ISIT): Als drittes Großprojekt plant das CC4E ein gemeinsam mit dem ISIT betriebenes Fraunhofer Anwendungszentrum Leistungselektronik für regenerative Energiesysteme am Energie-Campus. Hier gilt es, die politischen Entscheider zu gewinnen, damit die Stadt Hamburg die Anschubfinanzierung übernimmt.
Bei allen Projekterfolgen und Zuversicht sieht Werner Beba aber auch bestimmte strukturelle Grenzen, die es zu verändern gelte: „All das hat seine Grenzen. Momentan basieren die laufenden und geplanten Projekte auf viel persönlichem Engagement der Professorinnen und Professoren unserer Hochschule. Auf lange Sicht kann aber kaum jemand diese Mehrarbeit neben den regulären Aufgaben leisten. Hier haben Fachhochschulen einen strukturellen Nachteil. Es müssen daher Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine größere Flexibilität bieten, damit wir geeignete Kolleginnen und Kollegen für anspruchsvolle Forschungsprojekte auf Universitätsniveau motivieren können. Über die Wege muss intensiv diskutiert werden.“