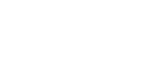Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen

Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Friedenswissenschaft eine unmittelbare Aktualität bekommen.

Mit dem Angriffskrieg hat die Friedenswissenschaft eine unmittelbare Aktualität bekommen. Hat sich Ihre Arbeit seitdem verändert?
Unmittelbare Aktualität hatte Friedenswissenschaft bereits vorher. Neben dem Krieg in der Ukraine gab und gibt es viele weitere kriegerische Auseinandersetzungen in der Welt, wie im Jemen, in Syrien oder der Türkei. Ich bin der festen Überzeugung, dass militärische Einsätze keinen Frieden schaffen können, sondern dass wir als Zivilgesellschaft gefragt sind, Lösungen für friedliche Entwicklungen zu erarbeiten. Darin spielen Hochschulen eine besonders wichtige Rolle. Was sich jedoch geändert hat, ist, dass viele Länder, auch Deutschland, momentan massiv aufrüsten – mit Geldern, die in der Bildung, aber auch im Gesundheitswesen oder für soziale Einrichtungen dringend benötigt werden. Dabei sind wir für einen viel stärkeren, uneingeschränkten Ausbau internationaler, ziviler Kooperationen. Nur gemeinsam können wir an globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder der Überwindung der Armut arbeiten. Zudem beschäftigt uns, dass momentan von verschiedenen Seiten laut drüber nachgedacht wird, ob die rund 70 Zivilklauseln an deutschen Hochschulen und Universitäten wieder abgeschafft werden sollen, da sie unzeitgemäß und hinderlich seien. Wir streiten zusammen mit der bundesweiten Zivilklauselbewegung dafür, dass noch mehr Wissenschaftseinrichtungen dazukommen und sich statt einer militärischen für eine zivile, soziale und friedensorientierte Zeitenwende einsetzen.
An der HAW Hamburg haben wir uns jetzt vorgenommen, den AK Friedenswissenschaft hochschulweit bekannter zu machen und aus verschiedenen Bereichen neue Interessierte zu gewinnen. Denn für alle Studiengänge steht dieselbe Frage auf der Tagesordnung: Wie schaffen wir Frieden? Das hat beispielsweise im Bereich Medien eine andere Konkretion als im Bereich Technik. Aber auch interdisziplinäre Projekte lassen sich unter der Fragestellung gut entwickeln.
An der HAW Hamburg haben wir uns jetzt vorgenommen, den AK Friedenswissenschaft hochschulweit bekannter zu machen und aus verschiedenen Bereichen neue Interessierte zu gewinnen. Denn für alle Studiengänge steht dieselbe Frage auf der Tagesordnung: Wie schaffen wir Frieden?
Den Auftakt hat ein Kennenlerntermin am 5. Oktober gemacht. Wie war die Resonanz aus der Hochschule?
Bei unserem Treffen am Berliner Tor 5 waren wir ein kleiner Kreis von bereits Aktiven und neu Interessierten. Wir wünschen uns eine größere Auseinandersetzung mit dem Thema Frieden an der Hochschule. Denn Frieden ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Die HAW Hamburg hat sich beispielsweise den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN, den Sustainable Development Goals, kurz SDG, verschrieben. Das finden wir richtig gut. Frieden ist darin das Ziel 16. Außerdem umfassen die Ziele die Überwindung von Hunger und Krankheiten, die Geschlechtergleichstellung und insgesamt ein gutes Leben für alle in gesunden Ökosystemen. Entscheidend ist an diesen SDGs, dass sie nur gemeinsam verwirklicht werden können. So, wie wir auch hier bei uns das große Thema Frieden nur zusammen anpacken können. Als Arbeitskreis wollen wir uns dafür zukünftig auch an den Standorten Finkenau und Bergedorf, sowie an der Alexanderstraße treffen, um stärker präsent zu sein.
Die Zivilklausel der HAW Hamburg geht auf eine Initiative von Studierenden zurück. Welche Bedeutung hat diese Klausel für die Lehre, Forschung und Arbeit an der Hochschule?
Die Zivilklausel steht bei uns an der HAW Hamburg in der Präambel der Grundordnung, die wiederum wie eine Art Verfassung der Hochschule zu verstehen ist. So ist sie ein positiver Bezugspunkt und Kompass für das Handeln in der Forschung, in der Lehre, im Studium und in der Arbeit. In der Praxis bedarf es allerdings unserer Ansicht nach einer stärkeren Auseinandersetzung mit diesen Ansprüchen. Wie bereits im Kontext der SGDs erkennbar wird, haben wir zum Beispiel mit Studienfächern wie Ernährungswissenschaften, oder mit den Arbeiten am CC4E und dem Green Office unmittelbare Möglichkeiten, Lösungen für die globalen Menschheitsprobleme zu erarbeiten.
Wichtig ist uns diese positive Orientierung: Es geht nicht nur darum Kriege zu beenden, sondern explizit eine progressive Entwicklung der Gesellschaft voranzutreiben.
Wir setzen darauf, dass durch eine verstärkte offene Diskussion an der Hochschule die Zivilklausel wieder stärker präsent wird, sich neu vertieft in unserem Hochschulalltag verankert und damit auch durchsetzen lässt.
Die Zivilklausel steht bei uns an der HAW Hamburg in der Präambel der Grundordnung, die wiederum wie eine Art Verfassung der Hochschule zu verstehen ist. So ist sie ein positiver Bezugspunkt und Kompass für das Handeln in der Forschung, in der Lehre, im Studium und in der Arbeit.
Welche Aktivitäten plant der Arbeitskreis aktuell und wie können sich Interessierte beteiligen?
Für eine kommende Veranstaltung haben wir uns gerade anhand einer historischen Auseinandersetzung damit beschäftigt, welche Rolle Wissenschaftler*innen in politischen und gesellschaftlichen Fragen einnehmen sollten: Ist Wissenschaft neutral oder sollte sie Mit-Gestalterin sein? Das Beispiel: Ende der 1950er gab es unter Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß Bestrebungen, die Bundeswehr mit Atomwaffen auszurüsten. Dagegen schlossen sich 18 führende Atomwissenschaftler als Gruppe “Göttinger Achtzehn” zusammen und sprachen sich gegen Atomwaffen aus. Sie haben mit ihrem wissenschaftlichen Blick auf die Gefahren die Diskussion versachlicht. Ihre Forderungen wurden von der Friedensbewegung aufgegriffen, unter anderem gab es große Proteste von Studierenden, und die Atomwaffen wurden letztendlich nicht angeschafft! Das ist ein positives Beispiel für Verantwortung von Wissenschaft. Was lernen wir für heute daraus? Das soll die Leitfrage für die nächste Veranstaltung sein.
Wer jetzt Interesse hat, uns und unsere Arbeit kennenzulernen, kann gerne zu unseren Treffen kommen. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat, das nächste Mal am Donnerstag, 17. November, um 16.00 Uhr in der Alexanderstraße 1. Für besondere Aktions- und Veranstaltungsplanungen sind dann nach Absprache in kleineren Gruppen weitere Treffen. Hier kann sich auch jede*r nach Interesse und Zeit unterschiedlich einbringen.