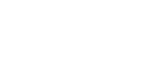Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Supermarkt vor dem Kühlregal: zwei Packungen Hühnerbrust – die eine aus konventioneller Tierhaltung, die andere aus einem Labor, für die kein Tier sterben musste. Zu welcher greifen Sie? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine aktuelle Studie von Julia Völker, Hannah Oestreich und Prof. Dr. Stephan Meyerding an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg). Die Ergebnisse wurden jetzt im Fachjournal Sustainability veröffentlicht.
In-vitro Fleisch, auch Labor- oder kultiviertes Fleisch genannt, wird nicht durch Schlachtung gewonnen, sondern aus tierischen Zellen gezüchtet. Dafür werden Muskelstammzellen entnommen, in einem Nährmedium vermehrt und in Bioreaktoren zu Muskelgewebe aufgebaut. In Deutschland und der EU ist In vitro Fleisch bisher nicht zugelassen. Es fällt unter die Novel-Food-Verordnung und muss von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit geprüft werden. Ein erstes deutsches Unternehmen hat 2023 einen Antrag für eine zellkultivierte Wurst eingereicht, sodass eine Zulassung frühestens ab 2026 realistisch ist.
In-vitro-Fleisch gilt als vielversprechende Alternative zu herkömmlichem Fleisch. Es könnte Tierleid reduzieren, Umweltbelastungen verringern und langfristig sogar gesünder sein. Doch: Ob Verbraucherinnen und Verbraucher solche Produkte tatsächlich kaufen, hängt entscheidend von der Verpackung ab.
Das Forschungsteam führte ein Online-Experiment mit 200 Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland durch. Die Teilnehmenden wählten zwischen verschiedenen fiktiven Packungen von Labor-Hühnerfleisch, die sich in Preis, Herkunft, Kaloriengehalt und Front-Labels unterschieden. Getestet wurden vier Kennzeichnungen:
- „Bio“,
- „Cruelty-Free“ (tierleidfrei),
- „Stop Climate Change“,
- und der Nutri-Score.
Die Ergebnisse sind eindeutig:
- Labels sind der stärkste Treiber für die Kaufentscheidung, noch vor dem Preis.
- Besonders „Bio“ und „Cruelty-Free“ erhöhen die Kaufbereitschaft deutlich, während der Nutri-Score nur geringen Einfluss hat.
- Die Konsumenten lassen sich in vier Gruppen einteilen – von preisbewussten Käuferinnen und Käufern bis hin zu umwelt- und werteorientierten Verbrauchern.
Implikationen für Politik, Industrie, Verbraucherinnen und Verbraucher:
- Politik kann durch klare Regelungen und glaubwürdige Labelstrategien die Akzeptanz von In-vitro-Fleisch fördern und so Umwelt- und Tierschutz stärken.
- Lebensmittelindustrie und Handel sollten auf transparente Kennzeichnung und glaubwürdige Siegel setzen, um den Markteintritt zu erleichtern.
Verbraucherinnen und Verbraucher könnten künftig leichter nachhaltige Entscheidungen treffen, ohne auf Fleischgeschmack zu verzichten.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Einführung von Laborfleisch in Deutschland nicht nur eine Frage der Technologie ist, sondern vor allem von Vertrauen und Kommunikation abhängt“, erklärt Prof. Dr. Stephan Meyerding, Projektleiter der Studie. Hauptautorin Julia Völker ergänzt: „Mit den richtigen Labels können wir Brücken zwischen Innovation und Verbraucherakzeptanz bauen.“