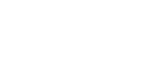Die Covid-19-bedingten Einschränkungen haben unser soziales Leben stark verändert. Social Distancing ist zur neuen Normalität geworden, das Zuhause für viele das Büro und die Jogginghose zum Hauptkleidungsstück avanciert.
Aber schon vor der Pandemie 2020 gab es Menschen, die sich über einen längeren Zeitraum von der Gesellschaft, dem Freundes- und Bekanntenkreis oder dem Arbeitsplatz zurückgezogen haben. „Die Fachwelt bezeichnet eine solche Selbstisolation von mehr als sechs Monaten als extremen sozialen Rückzug; der japanische Begriff `Hikikomori´ steht dafür,“ erklärt die Soziologin Dr. Sabina Stelzig von der HAW Hamburg. Sie untersucht jetzt das Phänomen im Rahmen eines Forschungsprojekts. „Dabei bestehen außerhalb der Familie keine Kontakte und es findet keine Teilnahme an sozialen Aktivitäten statt, Ausbildung und Arbeit eingeschlossen. Viele der Betroffenen werden auch als Erwachsene noch von ihren Familien versorgt.“
Die Perspektive „Hikikomori“ einnehmen
Das Forschungsprojekt zum extremen sozialen Rückzug in Familien ist am Department Soziale Arbeit angesiedelt und will untersuchen, inwiefern die Perspektive „Hikikomori“ das Verständnis und den Umgang mit Menschen im extremen Rückzug verbessern kann. Der soziale Rückzug aus dem Verständnis von Hikikomori stellt die mögliche psychische Störung nicht in den Vordergrund. Vielmehr wird versucht, den Rückzug ganzheitlich zu betrachten. „Der soziale Rückzug ist bei einem sogenannten primären Hikikomori kein Symptom einer psychischen Störung. Die Entstehung einer psychischen Störung wird aber mit einer längeren Dauer wahrscheinlicher. Bei einem sekundären Hikikomori hingegen ist davon auszugehen, dass eine psychische Störung wie eine Depression oder Angststörung Auslöser des Rückzugs sein können. In beiden Fällen geraten individuelle oder äußere Faktoren in den Fokus, die eine Untersuchung aus einer interdisziplinären Perspektive sinnvoll erscheinen lassen“, erklärt Dr. Stelzig.
Fördert Corona den sozialen Rückzug?

Extremer sozialer Rückzug durch Corona-Maßnahme "Stay Home"?
Dabei bestehen außerhalb der Familie keine Kontakte und es findet keine Teilnahme an sozialen Aktivitäten statt, Ausbildung und Arbeit eingeschlossen.
Selbstisolation kann durch Corona-Maßnahmen gefördert werden
Zudem soll untersucht werden, inwiefern pandemiebedingte Maßnahmen der Selbstisolation die Entstehung von extremem sozialem Rückzug beeinflusst. Die Forscher*innen wollen wissen, ob die monatelange Einhaltung der Maßnahmen eine Rückkehr in das soziale und eigenständige Leben erschwert. Zum Phänomen des extremen sozialen Rückzugs gibt deutschlandweit bislang kaum Untersuchungen. Das Forschungsprojekt an der HAW Hamburg möchte daher zunächst die Verbreitung des Phänomens ermitteln. Danach erfolgt die Analyse zu Strategien des Umgangs mit betroffenen Personen und Familien. „Wir beziehen auch die Rolle verschiedener Hilfesysteme aus dem psychosozialen und medizinischen Bereich mit ein und wollen herauffinden, welche Bedarfe hier bestehen“, ergänzt Psychologin Prof. Dr. Katja Weidtmann, sie ist mit im Forscherinnen-Team und Leiterin des Teams Angewandte Familienwissenschaften. „Zudem interessiert uns mittlerweile auch, ob das Aufrechterhalten von Maßnahmen zum Social Distancing und das sich zuhause Einigeln auch nach Abflauen der Pandemie zu einem dauerhaften Rückzug von der Gesellschaft führen kann. Dies wird aktuell unter dem Begriff `Cave-Syndrom´ diskutiert".
Weitere Informationen
Die Forscherinnen haben für ihre Erhebungen einen Fragebogen für Fachkräfte entworfen.
Damit wollen sie den ersten Schritt ihrer Forschungen jetzt starten:
Kontakt
Fakultät Wirtschaft und Soziales
Department Soziale Arbeit
Dr. Sabina Stelzig-Willutzki
Tel. 040 42875 7157
sabina.stelzig-willutzki (at) haw-hamburg (dot) de
FÜR RÜCKFRAGEN ZUM FORSCHUNGSPROJEKT
hikikomori (at) haw-hamburg (dot) de