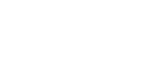Bauteile, die früher aufwändig an Drehbänken gefertigt wurden, können heute schnell und effizient 3D-gedruckt werden. Kein Wunder, dass die additive Fertigung und der 3D-Druck im Maschinenbau an Bedeutung gewinnen. „Die Technologie hat einige Vorteile, die traditionelle Fertigungsverfahren nicht bieten können“, erklärt Prof. Jens Telgkamp, Professor für additive Fertigung am Department für Maschinenbau und Produktion.
Effizient, individualisierbar, kostengünstig
Beispielsweise kann ohne formgebendes Werkzeug gedruckt werden, denn das Bauteil entsteht – Schicht für Schicht – in der additiven Fertigungsmaschine aus einem digitalen Datensatz. Es wird, beispielsweise in einem 3D-Drucker, Schicht für Schicht aus formlosem Material wie Kunststoff oder Metall aufgebaut, bis es die gewünschte Form hat. Auch komplexe Formen und Oberflächen „aus einem Guss“ sind möglich. Dies sei beispielsweise beim Bau von Prototypen vorteilhaft, so Telgkamp.
„Im Vergleich zu einer traditionellen Serienfertigung, bei der alle Bauteile gleich beschaffen sind, kann man in der additiven Fertigung stärker individualisieren“, erklärt Telgkamp die Vorteile des Verfahrens. „Durch die Gestaltungsfreiheit kann man Strukturen herstellen, die konventionell nicht zu fertigen wären, beispielsweise mit weniger Gewicht oder mit einer höheren Leistungsfähigkeit.“
Telgkamp stellt die Fachtagung jedes Jahr zusammen mit seinem Team auf die Beine. Neben den Schwerpunkten 3D-Druck und Additive Manufacturing werden aktuelle Themen der Technologie wie Simulation, Überwachung des Druckprozesses und die Qualitätssicherung diskutiert und beleuchtet, sowie Erfolgsstorys aus Bereichen präsentiert, in denen man die Additive Fertigung nicht vermuten würde: Schiffspropeller und Brillengestelle. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Ausstellung von 3D-Druckern und Modellen von Dienstleistern.
Additive Fertigung im Studium
Natürlich spielt das Thema auch bei der Ausbildung angehender Ingenieur*innen eine Rolle. Studierende lernen bei ihm und seinem Kollegen Prof. Sharam Sheikhi bereits früh im Studium, die additive Fertigung gezielt einzusetzen. Dafür können sie beispielsweise den 3D-Space der Fakultät Technik und Informatik nutzen. „Dort können sie in Filamentdruck, Pulverbettdruck oder Stereolithographie ihre Kunststoffbauteile drucken“, sagt Telgkamp. Der 3D-Space ist dabei kein reiner Dienstleister für die Studierenden. Vielmehr lernen sie von unseren Tutor*innen, Bauteile zu konstruieren und 3D zu drucken. „Außerdem gibt es an unserem Institut industrielle Maschinen für den Druck von metallgefüllten Kunststoffen. In einem nachgelagerten Sinterprozess – einem speziellen Verfahren um Metallteile herzustellen – entstehen dann massive 3D-gedruckte Metallteile“, so Telgkamp. Weitere industrielle Metall-Drucker befänden sich bei Prof. Sheikhi am Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik.