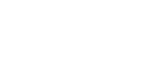In diesem Beitrag werden mögliche Gestaltungsmomente einer ‚wissenschaftsgeleiteten Wirkungsreflexion‘ (Ditzel, 2023) skizziert. Diese beschreiben, wie sich Evaluation, Reflexion und Wirkungsorientierung der Praxis des Lehrens, Lernens und der Curriculumsentwicklung von klassischen Ansätzen der Evaluation und der Wirkungsanalyse unterscheiden können. Umrissen werden damit Akzentverschiebungen von einer legitimations- und kontrollorientierten zu einer lern- und entwicklungsorientierten Evaluation sowie von einem Fokus auf Wirkungsnachweise zum Verstehen und Hinterfragen der Wirkungsweise von Interventionen.
Evaluation und Wirkungsbetrachtungen sind Themen, die seit einiger Zeit die Gestaltung, Weiterentwicklung und Steuerung der Praxis des Lehrens und Lernens begleiten. Im Zuge der Institutionalisierung von Ansätzen der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements finden vielfältige Formen der Evaluation statt (Mitterauer, 2018; Pohlenz, 2018). Es werden Daten zur Lehre, zu Studiengängen, zu Studienbedingungen sowie zum Prüfungs- und Studierverhalten bereitgestellt, die Eingang finden in Entscheidungsprozesse. Durch projekthafte Formen der Förderung von Lehrinnovationen richtet sich der Fokus zudem auf die Wirkung(en) und Wirksamkeit von Maßnahmen sowie zugrundeliegende Wirkannahmen und Wirkmechanismen (Stiftung Innovation in der Hochschullehre, 2020, 2024).
Dabei stehen Evaluation, QM und der Umgang mit Daten vor einigen grundlegenden Herausforderungen: Erstens stehen angesichts eines Fokus auf Legitimations- und Kontrolllogiken (Ditzel, 2022; Steinhardt et al., 2018) Ansätze der Evaluation im Hintergrund, die sich stärker auf Feedback, Lernen und Entwicklung sowie Forschen und Verstehen richten. Zweitens geraten klassische, insbesondere quantitative Ansätze der Wirkungsanalyse infolge komplexer Interaktionsgeschehen an ihre Grenzen (Altfeld et al., 2015). Und drittens stehen angesichts der ungewissen Ausgestaltung einer ‚Hochschulbildung der Zukunft‘ (Wassmer et al., 2023) Ansätze der Qualitätssicherung und -entwicklung unter Druck, die von einer planbaren Zukunft, von einheitlichen und verbindlichen Standards, von der Objektivität von Daten und von der Steuerbarkeit der Lehr- und Lernpraxis ausgehen. Gebraucht werden agile, kontextsensible Ansätze, die einen vorantastenden Handlungsmodus verbinden mit einer fortwährenden, strukturell abgesicherten, wissenschaftlich fundierten Reflexion der Effekte (Ditzel, 2023, S. 66). Die Frage stellt sich, wie solche Ansätze der Evaluation/Reflexion/Wirkungsorientierung aussehen können.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns im Projekt KOMWEID (Kompetenzen weiterentwickeln im digitalen Wandel) der HAW Hamburg damit auseinandergesetzt, wie ein systematischer, in die Praxis integrierter Blick auf Wirkung und wie wissenschaftsgeleitete Ansätze der Evaluation des Projekts und seiner Maßnahmen ausgestaltet werden können. Als theoretischer Rahmen wurde das Konzept einer ‚wissenschaftsgeleiteten Wirkungsreflexion‘ (Ditzel, 2023) entwickelt, mit Bezügen zur Evaluations- und Organisationswissenschaft. Im Kern geht es um einen wirkungsorientierten, forschend-fragenden, reflektierenden Blick auf die Handlungspraxis, bei dem Evaluation eine Grundlage für Reflexion und Lernen liefern. Dies lässt sich entlang von sechs Gestaltungsmomenten beschreiben:
- Wirkungsorientierter Ansatz der Gestaltung und Reflexion:
Erstens richtet sich das Erkenntnisinteresse darauf, das komplexe Interaktionsgeschehen des Lehrens und Lernens besser zu verstehen sowie zugrundeliegende Denk- und Handlungsweisen zu hinterfragen. Es wird danach gefragt, welche Effekte das Handeln hervorbringen soll und hervorbringt (Wirkung), wie Maßnahmen oder Handlungskonstellationen wirken (Wirkungsweise), inwiefern zuvor definierte Ziele erreicht werden (Wirksamkeit) und welche Denkweisen dem Handeln zugrunde liegen (Wirkannahmen).
- Wissenschaftsgeleiteter Ansatz der Evaluation:
Zweitens dienen wissenschaftlich fundierte Ansätze der Evaluation als Ausgangspunkt für Reflexionsprozesse. Dabei geht es nicht nur um eine methodische Fundierung und ein systematisches Vorgehen von Evaluation, sondern auch um ein Explizieren und Hinterfragen der Bezugspunkte der Reflexion (Balzer & Beywl, 2018). Evaluation lässt sich damit als wissenschaftliche Praxis verstehen, die einen fragend-forschenden Blick auf die Praxis richtet.
- Integration von Reflexion in die Handlungspraxis:
Drittens werden anknüpfend an eine systemtheoretische Einordnung von Interventionen in soziale Systeme sowie das ‚Primat der Selbststeuerung‘ (Willke, 1989) Evaluation und Reflexion als in die Handlungspraxis zu integrierend verstanden. Es betrifft jede/jeden. Damit geht ein verändertes Rollenverständnis einher, bei dem Evaluation nicht für, sondern mit den Handelnden geplant, entwickelt, durchgeführt und ausgewertet wird.
- Vielfalt der Betrachtungsobjekte und Evaluationsmethoden:
Viertens eröffnet sich ein vielfältiger Möglichkeitsraum, bei dem Evaluation und Wirkungsreflexion sich nicht nur auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche – wie Lehren, Lernen, Curricula, Unterstützungsstrukturen oder deren organisationale Rahmung und Steuerung – beziehen kann, sondern auch unterschiedliche Formen und Formate – wie standardisierte Umfragen, qualitative Interviews, selbstläufige Gruppendiskussionen oder die Auswertung quantitativer Daten – zum Einsatz kommen können.
- Verknüpfung von Fremd- und Selbstreflexion:
Fünftens spielen neben Evaluationsinstrumenten, mit denen eine Fremdsicht auf zu evaluierende Gegenstandsbereiche erfolgt, Momente der Selbstreflexion eine wichtige Rolle, um sich die Ziele, Wirkannahmen und Kontextbedingungen der Handlungspraxis zu vergegenwärtigen und sie kritisch zu hinterfragen.
- Ausweiten von Reflexion auf implizite Denk- und Handlungsstrukturen:
Sechstens erscheint es wichtig, in der Reflexion auf die Ebene von Handlungstheorien im Sinne des Zweischleifen-Lernens (Argyris & Schön, 2018) bzw. einer perspektivenorientierten Reflexion (Pietsch & Scherm, 2004) vorzudringen. Es geht darum, nicht nur die expliziten Bewertungen, sondern auch die impliziten Werthaltungen (Bohnsack, 2020) zu analysieren und damit einer (kritischen) Reflexion zugänglich zu machen. Qualitative Methoden spielen dafür eine wichtige Rolle.
Entlang dieser Gestaltungsmomente lässt sich beschreiben, wie sich Wirkungsreflexion von klassischen Ansätzen der Evaluation und des QM unterscheidet und welche Akzentverschiebungen damit von Legitimation/Kontrolle zu Entwicklung/Forschung einhergehen.
Im Projekt KOMWEID haben wir unterschiedliche Aspekte und Formate einer solchen Wirkungsreflexion angewendet und erprobt. Dabei wurde deutlich, welcher Mehrwert mit diesem Blick auf Evaluation und Reflexion einhergehen kann. Deutlich wurde auch, dass es sich um ein für Innovationsprojekte und generell die Praxis des Lehrens und Lernens anspruchsvolles Anliegen handelt, das mit vielfältigen Herausforderungen einhergeht.