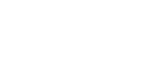30.000 Infektionen in 74 Ländern innerhalb weniger Wochen: Im Frühjahr 2009 bricht die Schweinegrippe aus. Zuerst erkranken Menschen in Mexiko und den USA an dem Subtyp des Influenza-A-Virus H1N1. Schnell gibt es auch in Europa erste Fälle. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor einer weltweiten Pandemie und ruft Mitte Juni 2009 die höchste Warnstufe aus. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits rund 30.000 Infektionen in 74 Ländern registriert. Erste Vergleiche zur spanischen Grippe geistern durch die Öffentlichkeit. 1918/19 sorgte dieser H1N1-Subtyp für weltweit 50 Millionen Todesopfer.
Solch verheerende Ausmaße nimmt die Schweinegrippe zum Glück nicht an. Schon im August 2010 kann die WHO die Pandemie für beendet erklären. Nach ihren Angaben sterben 18.446 Menschen an der Influenza. Schon bald nach der Eindämmung wird berechtigte Kritik am Handeln der WHO laut. Ihre groß angelegten Impfkampagnen laufen ins Leere. Die Grippe-Symptome werden in der Bevölkerung als nicht sonderlich gefährlich wahrgenommen. Schnell gibt es Gerüchte um mögliche Nebenwirkungen der Impfstoffe. Die Folge: Nicht einmal jeder zehnte Deutsche lässt sich gegen die Schweinegrippe impfen. Große Mengen der Medikamente wandern später in den Müll, während es in Polen erst gar keine Impfungen gibt.
Welche Fehler wurden bei der Kommunikation gemacht? „Bei der Schweinegrippe wurden einige Fehler in Sachen Koordination und Kommunikation gemacht. Zum Beispiel hat die WHO zwar viele Informationen herausgegeben, aber zu wenig über ihre Wirkung nachgedacht“, sagt Dr. Ralf Reintjes, Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung an der HAW Hamburg.
Aus solchen Fehlern zu lernen, ist ein erklärtes Ziel des interdisziplinären EU-Projektes „ECOM@EU“. Gemeinsam mit Kollegen aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Großbritannien und den USA sucht Reintjes dabei nach besseren Strategien der Krisenkommunikation. Die Besonderheit des vierjährigen Forschungsprojektes liegt in der Vielzahl verschiedener Perspektiven. Am Medical Center der University Rotterdam untersuchen beispielsweise Epidemiologen unter Leitung von Professor Jan Hendrik Richardus das Impfverhalten und den Erfolg von entsprechenden Kampagnen in fünf europäischen Ländern.
Am Department für Gesundheitswissenschaften der HAW Hamburg wurde der Verlauf der Schweinegrippe rekonstruiert. Ergänzt werden solche eher epidemiologisch-medizinischen Untersuchungen durch die Expertise von Social Marketing Experten, Medienwissenschaftlern und Psychologen. „Durch die unterschiedlichen Perspektiven haben wir in den letzten vier Jahren viel über die Aufmerksamkeit und die Wirkung von Risikokommunikation während einer Pandemie gelernt“, erklärt Projektkoordinator Jan Hendrik Richardus von der Universität Rotterdam.
Internationale Experten aus dem Forschungsteam wollen Informationen besser aufbereiten: „Trotz solcher Erfahrungen wird Phänomenen wie dem Vertrauensverlust oder einer Aufmerksamkeitsentwicklung bei der Entwicklung von Kommunikationsstrategien bisher nur wenig Beachtung geschenkt“, sagt Richardus. Epidemiologe und Public-Health-Experten beraten zwar über die nötigen Informationen für die Bevölkerung, nicht aber über ihre optimale Aufbereitung für die verschiedenen Zielgruppen. Um solche Planungen in Zukunft zu erleichtern, werden im Rahmen des „ECOM@EU“-Projektes auch konkrete Handlungsempfehlungen für eine bessere Risikokommunikation seitens Gesundheitsorganisationen entwickelt. „Wir können die Mechanismen der Aufmerksamkeit schwerlich ändern. Aber je genauer wir sie verstehen, desto besser können wir sie für unsere Zwecke nutzen“, fügt Reintjes hinzu. Zum Beispiel wurde in Zusammenarbeit mit der Kölner Kreativagentur Elastique eine kostenlose Pandemie-Information-App entwickelt. Die Idee: Die anfängliche Aufmerksamkeit seitens der Medien wird genutzt, um die Smartphone-App bekannt zu machen und so einen zuverlässigen Kommunikationskanal aufzubauen.
Einfache und verständliche Botschaften für jedermann - das ist das Ziel: Auch über die Aufbereitung der Informationen für verschiedene Zielgruppen haben sich die Forscher Gedanken gemacht. Die Faustregel dabei: Je einfacher und anschaulicher die Informationen aufbereitet werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Menschen die Situation richtig einschätzen. „Wenn die Kommunikation mit einheitlichen und verständlichen Botschaften auf möglichst vielen Kanälen funktioniert, könnte das bei der nächsten Pandemie viele Menschenleben retten“, ist sich Professor Reintjes sicher. Die Grundlage dafür legen er und seine Kollegen im November 2015. Dann wird der Abschlussbericht samt Handlungsempfehlungen dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle (ECDC) in Stockholm vorgestellt. Im Themendienst für Journalisten im November 2015 und auf der HAW Homepage www.haw-hamburg.de wird dann weiter ausführlich berichtet. (Autor: Birk Grüling)
Kontakte:
Fakultät Life Sciences der HAW Hamburg
Department Gesundheitswissenschaften
Prof. Dr. Ralf Reintjes
Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung
Tel.: +49.40.428 75-6104
<link mail window for sending>ralf.reintjes@haw-hamburg.de
Forschung Team Public Health
Amena Ahmad
Tel.: +49.40.428 75-6160
<link mail window for sending>amena.ahmad@haw-hamburg.de