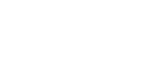Was bedeutet nachhaltige Sporternährung überhaupt?
Sibylle Adam:
Beim Begriff „Nachhaltige Ernährung“ beziehen wir uns auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE). Der WBAE definiert darin vier zentrale Aspekte für eine nachhaltige Ernährung: Gesundheit, Soziales, Umwelt und Tierwohl. Genau um diese Bestandteile sollte es bei einer nachhaltigen Ernährung gehen. Das Thema reicht also weit über eine gesunde Ernährung hinaus.
Und wieso der Fokus auf die Sporternährung?
Anja Carlsohn:
Zum einen gibt es in Deutschland rund 20 Millionen Sportreibende, die viele Fragen zu Ernährungsempfehlungen haben, mit denen sie ihre individuellen Trainingsziele erreichen können. Zudem fokussieren sich viele Sporttreibende nicht nur auf ihre ganz persönlichen Ernährungs- und Trainingsziele, sondern möchten sich gleichzeitig auch nachhaltiger ernähren und einen Beitrag zur nachhaltigeren Ernährung leisten. Gleichzeitig sind Übergewicht und Adipositas, also ein krankhaftes bzw. krankmachendes Übergewicht, sehr verbreitet. Eine individuell bedarfsgerechte Ernährung in Kombination mit ausreichend Sport und Bewegung kann das Risiko lebensstilbedingter Erkrankungen erheblich reduzieren. Bekannte Spitzensportler*innen können hier ein Vorbild insbesondere auch für Kinder und Jugendliche sein, sich so zu ernähren, dass es ihnen selbst ebenso wie der Umwelt und der Gesellschaft (Stichwort: Fair trade, Tierwohl) gut tut.
Und wozu dient das neue Labor für nachhaltige Sporternährung genau?
Anja Carlsohn:
Im Studium der Ökotrophologie vermitteln wir viel theoretisches Wissen darüber, wie sich eine bestimmte Ernährungsweise auf den menschlichen Körper, aber auch auf Klima und Umwelt auswirkt. Außerdem lernen die Studierenden unterschiedliche Messmethoden kennen. Dafür bringen wir auch kleinere Messgeräte mit in die Kurse, um den Transfer von der Theorie in die Praxis zu leisten. In dem neuen Labor können nun weitere Methoden, Screening- und Diagnosetools in Lehrveranstaltungen ausprobiert und angewandt werden, sodass unsere Absolvent*innen verschiedene Erhebungs- und Forschungsmethoden der Ernährungsbetreuung dann auch in der Praxis sicher beherrschen.
Gab es ein extra-Budget für die Anschaffung neuer Geräte?
Sibylle Adam:
Die neuen Geräte wurden nach Bewilligung unseres begründeten Investitionsantrags, der ja regelmäßig von uns Lehrenden eingereicht werden kann, angeschafft. Wir haben uns sehr gefreut, dass diese Investition bewilligt wurde und unseren Studierenden nun tolle Möglichkeiten für das kompetenzorientierte und forschende Lernen im Bereich der Ernährungsbetreuung bietet.
Und können Sie ein paar Beispiele für die Geräte im Labor und wofür sie genutzt werden nennen?
Anja Carlsohn:
Mit Studierenden werden wir in Lehrveranstaltungen den sogenannten Ruheumsatz messen, also den Energieverbrauch, den eine individuelle Person in vollständiger körperlicher Ruhe hat. Mithilfe der Spirometrie können wir aber nicht nur den Ruheumsatz, sondern auch den individuellen Energieverbrauch sowie Stoffwechselraten bei Belastung, z.B. auf dem Laufband oder Radergometer messen. Das kann hilfreich sein, um Patient*innen oder Sportler*innen individuelle Bewegungs- bzw. Trainingsempfehlungen geben zu können. So lässt sich eine Belastungsintensität ermitteln, bei der die Sporttreibenden sich zum Beispiel im maximalen Fettverbrennungsbereich bewegen, was sie dann beim Heimtraining anhand der Herzfrequenz steuern können.
Zudem können wir neben einer vollständigen Ernährungsanalyse anhand von Verzehrprotokollen beispielsweise auch fettfreie und Fettmasse in den Extremitäten und im Rumpf erfassen, sodass z.B. Verlaufskontrollen z.B. nach verschiedenen Ernährungs- und/oder Trainingsinterventionen durchgeführt werden können. Solche Messungen sind nicht nur im leistungsambitionierten Sport sinnvoll, sondern auch bei älteren Menschen mit erhöhtem Risiko für Sarkopenie („Muskelschwund“). Veränderungen des Körpergewichts sind allein kein guter Indikator, da das Risiko besteht, bei adipösen oder übergewichtigen Menschen einen Verlust von Muskelmasse zu übersehen. Daher sind weitere Erhebungen wie z.B. Umfangsmaße von Oberarm und Wade oder Handkraftmessungen notwendig, bei uns im Labor möglich und sollen in Zukunft auch von Studierenden in der Lehre angewandt werden. Zudem evaluieren Studierende in der Lehrveranstaltung Sports Nutrition neben den beschriebenen anthropometrischen Parametern (fettfreie und Fettmasse, Umfangsmaße, Taille-Hüftindex) auch ihren eigenen Hydratationsstatus.
Aktuell wird ein Forschungsprojekt vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften gefördert, in dem wir Risikokonstellationen für ernährungsbezogene Gesundheitsrisiken im Sport u.a. mit unseren Screeningtools identifizieren wollen. Zudem laufen verschiedene Bachelorarbeiten, in denen es beispielsweise darum geht, Motivation und Maßnahmen von Freizeitsportler*innen zu analysieren und sportbezogene Ernährungsziele mit Aspekten einer nachhaltigeren Ernährung zu verbinden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Maren Borgerding