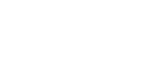Liebe Prof. Dr. Gaidys, wo liegen aus Ihrer Sicht besondere Herausforderungen für eine Professur in der Pflegewissenschaft und was macht sie vielleicht auch besonders spannend?
Prof. Dr. Gaidys: Die Pflegewissenschaft beschäftig sich mit der Frage, wie Menschen in Krankheitssituationen so unterstützt werden können, dass sie ihren Lebensalltag bewältigen können. Eine Professur in Pflegewissenschaft bedeutet diese Unterstützung im Lebensalltag handlungsorientiert lehren zu können, also pflegerisches Assessment, wie körperliche Untersuchungen, pflegerische Interventionen, wie Mobilisierungen als Handlung sowohl beispielsweise im Skills Lab aber auch in der Versorgungsrealität zu unterrichten. Dazu muss man/frau Menschen pflegen können.
Zudem bedeutet eine Professur in Pflegewissenschaft daran zu forschen, wie pflegerische Versorgung gesichert und verbessert werden kann, was es bedeutet, fürsorglich zu handeln, wie ethisch gerechtfertigt Entscheidungen für Gesundheitsversorgung gefällt werden können oder welche Ressourcen und Kompetenzen Menschen benötigen, die beispielsweise chronisch erkrankt sind.
Hinzu kommt, dass die Pflegewissenschaft eine sehr junge Wissenschaftsdisziplin ist. Deshalb ist es für eine Person, die eine Professur in Pflegewissenschaft hat, notwendig, die eigene Wissenschaft methodisch und fachlich kommunikativ darstellbar zu machen. Also in gesellschaftlichen und politischen sowie hochschulstrukturellen Diskursen präsent zu sein.
So eine Professur ist unglaublich vielfältig und erfordert ein hohes Maß an Gestaltungswillen. Aber ebenso braucht es immer wieder den Abgleich mit der Lebenswirklichkeit von Menschen, die pflegebedürftig und somit abhängig von professioneller pflegerischer Hilfe sind.
Im Projekt go-2-prof:in werden Potentialkandidat*innen für HAW-Professuren gefördert. Hierbei denkt man intuitiv an Post-Doc Stellen. Welche Motive stehen hinter der Entscheidung für den Bereich der Pflege- und Therapiewissenschaften in erster Linie Promotionsstellen zu schaffen?
Prof. Dr. Gaidys: Pflegewissenschaft ist eine anwendungsorientierte Wissenschaft. Sie ist in überwiegendem Maße an Hochschulen für angewandte Wissenschaften etabliert. Das ist auch gut so. Um allerdings die Akademisierung der Pflege und der Therapieberufe konsequent zu denken, brauchen wir Promotionsprogramme, die einerseits den wissenschaftlichen Nachwuchs sichern als auch andererseits Erkenntnisse generieren, mit denen wir die Versorgungspraxis besser machen können. Die HAW Hamburg ist in Lehre und Forschung ausgesprochen stark im Bereich Gesundheit und Akademisierung der Gesundheitsberufe. Wir brauchen deshalb gut ausgebildete Wissenschaftler*innen, die diese Disziplinen weiterentwickeln.
Liebe Frau Diskowski, was reizt Sie an einer wissenschaftlichen Laufbahn in den Therapie- bzw. Physiotherapiewissenschaften?
Diskowski: In den vergangen zehn Jahren habe ich im Querschnittgelähmten-Zentrum der BG Klinik Hamburg gearbeitet und möchte mich im Rahmen meiner Promotion thematisch der Rehabilitation von Menschen mit inkompletter Querschnittlähmung widmen. Während meiner Zeit als Physiotherapeutin habe ich viel über das Gelingen einer erfolgreichen Patient*innen-Versorgung gelernt. Diese kann meiner Erfahrung nach, in Anbetracht zunehmend komplexerer Diagnosen, limitierten zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen im Gesundheitswesen nur durch eine multiprofessionelle, partizipative Zusammenarbeit aller Leistungserbringenden gelingen. Dieses setzt voraus, dass allen Berufsgruppen im Gesundheitswesen die gleichen Möglichkeiten der praktischen Anwendung und Weiterentwicklung ihrer Handlungskompetenzen ermöglicht werden. Daher ist es mein Wunsch mit meinem Forschungsthema einen Beitrag zur Stärkung der wissenschaftlichen Handlungsbasis in den Therapieberufen zu leisten.
Von der Therapiebank zurück an die Hochschule - was bedeutet für Sie die Gelegenheit zu promovieren?
Diskowski: Für mich persönlich bedeutet die Promotion ein spannendes und chancenreiches Kapitel in meinem Berufsleben, über das ich mich sehr freue. Hinsichtlich meiner Tätigkeit als Physiotherapeutin hoffe ich einen Beitrag zur Professionalisierung der Berufsperspektiven und Mitbestimmung der Therapieberufe im Gesundheitswesen leisten zu können.
Mit dem BG-Klinikum Hamburg bzw. dem Katholischen Marienkrankenhaus haben Sie bereits einen Praxispartner für Ihr Promotionsprojekt. Weshalb ist eine Praxiskooperation für Ihr Promotionsprojekt relevant?
Diskowski: Die Praxiskooperation ist eine große Bereicherung für alle Beteiligten. Angewandte Wissenschaften brauchen das Anwendungsfeld und die Praxis benötigt die stetige Überprüfung und Anpassung der eigenen Prozesse und Handlungsweisen. Daher ist für mich dieses kooperative Promotionsprojekt zwischen der HAW Hamburg und der BG Klinik Hamburg ideal. Durch meine langjährige Arbeit im Querschnittgelähmten-Zentrum und durch die Unterstützung der HAW Hamburg kann ich Forschungsthemen aus der unmittelbaren Praxis identifizieren und im Rahmen dieser Kooperation bearbeiten.
Sadre-Fischer: Das Marienkrankenhaus setzt auf moderne Pflegekonzepte und -methoden, die in der Praxis erprobt und weiterentwickelt werden können. Dies bietet eine hervorragende Grundlage für empirische Forschung und die Entwicklung neuer Pflegeansätze. Ich finde es auch interessant, dass das Marienkrankenhaus mit dem ersten Integrierten Notfallzentrum Deutschlands eine einzigartige Gelegenheit bietet, die Rolle der Pflege in der Notfallversorgung zu untersuchen. Hier kann ich mir vorstellen, wie innovative Pflegepraktiken und deren Auswirkungen auf die Patientenergebnisse erforscht werden.
Die enge Zusammenarbeit mit dem Marienkrankenhaus ermöglicht mir, empirische Daten aus erster Hand zu sammeln und diese in meinem Forschungsprojekt zu integrieren. Ein wichtiger Aspekt einer Kooperation mit einem Praxispartner ist auch der direkte Wissenstransfer: Als Wissenschaftlerin bringe ich neues theoretisches und methodisches Wissen in die Praxis ein, während ich von den praktischen Erfahrungen der Pflegekräfte und der Krankenhausleitung profitiere. Diese wechselseitige Wissensvermittlung stärkt nicht nur die Forschung, sondern sorgt auch dafür, dass Innovationen schneller und praxisnaher umgesetzt werden können.
Liebe Frau Sadre-Fischer, Sie haben bereits den wechselseitigen Wissenstransfer besonders hervorgehoben. Was reizt Sie an einer wissenschaftlichen Laufbahn in der Pflegewissenschaft? Was möchten Sie in diesem Fachbereich persönlich beitragen?
Sadre-Fischer: Eine wissenschaftliche Laufbahn in der Pflegewissenschaft bietet die Möglichkeit, tiefgehende Erkenntnisse zu gewinnen, die die Pflegepraxis und -politik direkt beeinflussen können. Durch Forschung können wir nicht nur die Qualität der Pflege verbessern, sondern auch die Arbeitsbedingungen von Pflegenden und die Versorgung der Patient*innen optimieren.
Das Promotionsprogramm eröffnet mir die Chance evidenzbasierte Lösungen zu entwickeln, die sowohl die Bedürfnisse der Patient*innen als auch die der Pflegenden in den Mittelpunkt stellen. Vor allem im Bereich der Frauengesundheit oder auch in der Akut- und Notversorgung sehe ich großen Forschungsbedarf. Im Hinblick auf die Akademisierung der Pflege müssen wir die Rolle der Pflegenden stärken und Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Kompetenzen eingesetzt werden können. Dafür brauchen wir neue Konzepte und Ansätze in Deutschland.
Das Arbeiten an der Hochschule ist Ihnen bereits sehr vertraut. Was schätzen Sie hierbei und was reizt Sie nun in ein sehr praxisorientiertes Forschungsvorhaben einzusteigen?
Sadre-Fischer: Das Arbeiten an der Hochschule ist für mich ein vertrautes Umfeld, und ich schätze die Freiheit in Lehre und Forschung. Besonders wertvoll finde ich die Gelegenheit, über den Tellerrand hinauszublicken, interdisziplinär zu arbeiten und mit verschiedenen Akteur*innen zu kooperieren. Wir setzen den Fokus unserer Lehre und Forschung bereits auf den Theorie-Praxis-Transfer, dennoch ist der direkte Einfluss auf die Praxis nicht immer unmittelbar spürbar. In der praxisorientierten Forschung kann ich sicherstellen, dass die Themen und Probleme, mit denen ich mich befasse, direkt gesellschaftlich relevant sind. Und genau hier liegt der Unterschied.
Laut der Nacap-Umfrage 2019 sind weniger als ein Viertel der Promovierenden an deutschen Hochschulen Eltern. Wie blicken Sie innerhalb Ihrer Elternschaft auf diese Herausforderungen?
Sadre-Fischer: Ich möchte mit meinem Karriereweg mit Kindern zeigen, dass sowohl Familie als auch Karriere in der Wissenschaft möglich ist und Frauen* in diesem Bereich unterstützt werden sollten. Es heißt, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Dennoch stehen viele Eltern allein vor der Herausforderung der Kindererziehung und des Berufslebens. Ich glaube, dass eine gute Kombination aus praktischen Strategien und einer positiven Haltung gegenüber der Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft entscheidend ist: gutes Zeitmanagement, Unterstützung suchen und annehmen, Offenheit für flexibles Arbeiten und nicht zuletzt die gesellschaftliche Sensibilisierung. Ich denke, dass es insgesamt ein Umdenken in der Wissenschaft geben muss. Hin zu einer inklusiveren und flexibleren Struktur, die es Eltern ermöglicht, in ihrer Karriere erfolgreich zu sein, ohne dass ihre familiären Verpflichtungen als Hindernis angesehen werden.
Weitere Informationen im Hinblick auf eine HAW-Professur können Sie innerhalb der hybriden Informationsveranstaltung an der HAW Hamburg am 17.01.2025 um 15 Uhr Im Forum Finkenau erhalten.