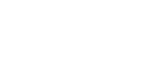Mit Sorgearbeit sind Tätigkeiten des Versorgens und Sich-Kümmerns gemeint. Klassische Beispiele liegen etwa im Bereich der familiären und ehrenamtlichen Sorgearbeit, wie die Erziehung und Versorgung von Kindern oder auch die Pflege und Unterstützung bei Behinderung(en) oder Krankheit(en). Aber auch die entlohnten Erziehungs-, Bildungs-, Pflege- und Haushaltsaufgaben sind dazu zu zählen. Care-Arbeit kann sich auch auf die zwischenmenschliche Beziehungspflege beziehen, etwa im romantischen und freundschaftlichen Rahmen oder im Arbeitskontext, zum Beispiel bei der Zusammenarbeit in Teams. Allerdings wird Sorgearbeit häufig nicht als solche erkannt und benannt.
Sorgearbeit wird maßgeblich von Frauen und weiblich gelesenen Personen geleistet, denen die sich kümmernden Tätigkeiten als „selbstverständlich“ zugeschrieben werden. Ohne dass Sorgearbeit die entsprechende Wertschätzung und Anerkennung erfährt. Berufe, in denen die Sorge um die*den Anderen im Zentrum stehen, werden zum Beispiel nicht angemessen entlohnt. Sorge-Arbeit wird zudem zunehmend an Migrant*innen aus dem Globalen Süden und Osten ausgelagert, die diese Tätigkeiten oft unter noch schlechteren Arbeitsbedingungen und unter noch prekäreren Bedingungen verrichten müssen. Um die Care-Arbeit gewährleisten zu können, reduzieren Frauen häufig ihre Erwerbsarbeit oder unterbrechen diese, was einen erheblichen Gender Pay Gap und ein stark erhöhtes Risiko für Altersarmut bei Frauen mit sich bringt.
Die geschlechtsspezifische Ungleichheit vertieft sich weiter, zieht man das Konzept des Mental Loads hinzu: Mental Load steht für die Belastung, die mit dem Management von Alltagsaufgaben und Organisation des Haushalts oder der Familie einher geht – dabei geht es also um die kognitive, unsichtbare Arbeit, die jedoch essenziell beispielsweise für das Familienleben ist. So zeigt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, dass auch diese Arbeit vor allem von Frauen erledigt wird. Zudem belegt die Studie, dass Männer ihren Beitrag am Funktionieren der Familie meist überschätzen: Sie vermuteten, sie würden gleich viel für die Familie tun wie Frauen – die Daten zeigen jedoch, dass sie erheblich weniger leisten.
Ob in Familienkontexten, in WGs, in Freund*innenschaften oder im Arbeitskontext - wie ist die Care-Arbeit in Ihrem Lebensalltag aufgeteilt? Wir möchten Sie einladen, die Verteilung von Care-Arbeit im eigenen Umfeld kritisch zu reflektieren – als Anregung kann dieser Test über Mental Load und Equal Care dienen.
Benötigen Sie Beratung und Unterstützung rund um Care-Arbeit und Vereinbarkeit? Das Familienbüro der HAW Hamburg unterstützt Sorgeleistende aller geschlechtlichen Identitäten mit seinen Angeboten. Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Familienbüros.