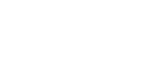Information und Austausch zum Verfahren des Struktur- und Entwicklungsplanes 2021 – 2025
Zum Verfahren des Struktur- und Entwicklungsplanes (SEP) 2021 – 2025 legte Präsident Prof. Dr. Micha Teuscher in der Hochschulsenatssitzung eine Übersicht über die Schritte der Entwicklung des SEP vor und erläuterte, dass es um die systematische Weiterentwicklung des vorangegangenen SEP 2016-2020 geht, da die grundsätzliche Struktur der acht identifizierten Handlungsfelder erhalten bleibt.
Für jedes Handlungsfeld sollen strategische Ziele abgeleitet werden, die die wichtigsten mittelfristig angestrebten Entwicklungen der HAW Hamburg beschreiben. Zentral ist dabei die inhaltliche Verschränkung der strategischen Ziele mit den spezifischen Entwicklungslinien der einzelnen Fakultäten.
Die Entwicklung des SEP 2021 – 2025 soll durch einen breiten Teilhabeprozess vor allem durch die Hochschulgremien erfolgen. <link https: www.haw-hamburg.de blaupause aktuelle-ausgabe aktuelldetails artikel struktur-und-entwicklungsplan-2021-2025-in-planung.html external-link-new-window external link in new>Lesen Sie hier einen ausführlichen Bericht zur Planung des SEP 2021 – 2025.
Konzept Digitalisierung von Verwaltungsprozessen
Zu Beginn des Tagesordnungspunktes führte Kanzler Dr. Wolfgang Flieger aus, die HAW Hamburg hat insbesondere in den wichtigen zentralen Bereichen bereits größtenteils digitale Prozesse umgesetzt, wie die Studierenden- und Finanzverwaltung sowie die Personalverwaltung. Trotzdem hat sich die Hochschule vorgenommen, die Verwaltung noch stärker zu digitalisieren. Der Einsatz von IT dient dabei keinem Selbstzweck, sondern wird im Kontext einer Prüfung und Validierung des Nutzens für die Mitglieder der Hochschule und die Organisation durchgeführt. Der zentrale Fokus liegt dabei auf der Erstellung von Prozessen, die klar definiert, schnell, verlässlich und transparent sind.
Für die Erstellung des Konzeptes Digitalisierung von Verwaltungsprozesse hat Projektleiter Roman Knolle zunächst den Stand der Digitalisierung bei anderen Hochschulen betrachtet und analysiert, welche Anwendungsinfrastrukturlösungen uns durch die Stadt Hamburg geboten werden. Zudem hat er mit internen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern an unserer Hochschule gesprochen und so eine Arbeitsplanung für die Jahre 2019 und 2020 vorgelegt. Als ein identifiziertes Teilprojekt soll zunächst im Bereich Personalservice die Prozesse des Einstellungs- und Bewerbungsverfahrens digitalisiert werden (<link https: www.haw-hamburg.de blaupause aktuelle-ausgabe aktuelldetails artikel die-haw-hamburg-kann-im-grossen-massstab-von-der-digitalisierung-profitieren.html external-link-new-window external link in new>lesen Sie hier einen ausführlichen Bericht zum Projektleiter Roman Knolle und dem Konzept ).
Im Anschluss an die Ausführungen von Herrn Flieger und Roman Knolle wurde von den Hochschulsenatsmitgliedern zum Beispiel die Ermöglichung einer stärkeren Transparenz von Prozessen durch deren Digitalisierung thematisiert. Hier antwortete Herr Knolle, ein Ziel des Projektes ist genau die nutzerbasierte Abbildung von Prozessen, die zu einer stärkeren Transparenz führen soll.
Auch die Kosten des Projektes wurden angesprochen. Herr Flieger führte dazu aus, dass die Kosten noch nicht abschätzbar seien. Die Beschaffung von Fachanwendungen, die Lizenzkosten, das Hosting und die System Administration werden sicherlich Kosten verursachen. Aber das Ziel, die Verbesserung von Prozessen und eine zeitliche Entlastung des Verwaltungspersonals, sollte uns dies wert sein. Hochschulratsmitglied Prof. Dr. Wolfgang Renz stellte die Frage, ob und gegebenenfalls wann über den Aushandlungsprozess zwischen Bedarf an Organisationsentwicklung und Anpassung der Softwarelösung berichtet wird. Der Kanzler antwortete, dass von einer angemessenen Aushandlung in den Einzelbereichen durch die Beteiligung aller betroffener Stakeholder auszugehen ist.
Bericht zur Forschungsstrategie
Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Thomas Netzel stellte in der Sitzung die aktuelle Fassung der Forschungsstrategie für die HAW Hamburg vor. Der Entwurf wurde ergänzt um Anmerkungen aus der Hochschulsenatssitzung im April 2018. Hinweise aus der auf der Klausurtagung im September 2018 von der AG des Hochschulsenats vorgestellten Präsentation wurden ebenfalls integriert. Der Vizepräsident dankte dem Hochschulsenat für die konstruktive Diskussion. Die zu veröffentlichende Fassung der Forschungsstrategie ist im März 2019 vom Präsidium beschlossen worden. Präsident Teuscher ergänzte, dass die Forschungsstrategie nicht festgeschrieben sei, sondern stetig weiterentwickelt wird, so auch im Rahmen der Diskussion zum Struktur- und Entwicklungsplan (SEP) für die Jahre 2021 – 2025.
Aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren des Hochschulsenats wird die Bedeutung einer Forschungsstrategie für die Außendarstellung der HAW Hamburg gesehen. Einzelne Stimmen vertreten die Meinung, es handele sich hierbei weniger um eine Strategie als vielmehr um eine Vision. Der Abschnitt „Mission“ enthalte gute Formulierungen, strategische bzw. operative Ziele seien jedoch nicht auf den ersten Blick erkennbar. Vizepräsident Netzel erwiderte, dass seit 2014 im Bereich Forschung an einer Strategie gearbeitet wird. Primäres Ziel war es damals, in der Forschung stärker zu werden, was inzwischen, wie unter anderem die Drittmittel-Zahlen zeigen, erreicht wurde. Die Grundlagen wurden gelegt. Die strategischen Ziele sind, wie auch im aktuellen SEP formuliert, weiterhin forschungsstärker zu werden, Lehre und Forschung miteinander zu koppeln, Grundlagen- und Anwendungsforschung zu verknüpfen sowie Innovationen und deren Transfer zu fördern.
Präsident Teuscher ergänzte dazu, dass vier Forschungsschwerpunkte an der HAW Hamburg ermittelt werden konnten, die an den Clustern der Metropolregion andocken und mit denen sich die Hochschule in der Region aufstellen möchte: Energie und Nachhaltigkeit, Gesundheit und Ernährung, Mobilität und Verkehr sowie Information, Kommunikation und Medien. Auch haben sich an der Hochschule aufgrund der Forschungs-, Entwicklungs- und Transferaktivitäten im Laufe der Zeit folgende Forschungsstrukturen etabliert: Competence Center, Forschungs- und Transferzentren, Forschungsgruppen, Einzelforscher und Graduierte, die in den Schwerpunkten und weiteren Themen mitarbeiten und diese weiter gestalten sollen.
Durch einen studentischen Vertreter wurde vom Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverband (SDSHAW) eine Stellungnahme zum Thema Freiheit von Forschung und Lehre verteilt, in der unter anderem kritisiert wird, dass es zu wenig inhaltliche Diskussion innerhalb der Hochschule gibt. Präsident Teuscher und Kanzler Flieger bekräftigten daraufhin den Grundsatz der Freiheit von Forschung und Lehre. Daher sollen mit der Forschungsstrategie Ermöglichungsräume an der HAW Hamburg für die Forschenden geschaffen werden. Eine Unterstützung kann sowohl aus den Fakultäten als auch zentral erfolgen. Es soll aber keine thematische Vorprägung geben, woran an der Hochschule geforscht wird.
Auch das Thema der begrenzten Ressourcen für Lehre und Forschung und der Wunsch nach einer stärkeren Konkretisierung an dieser Stelle wurde angesprochen. Vizepräsident Netzel erwiderte, dass es hier keine Konkurrenz gibt, da die Budgets entkoppelt sind. Zudem ist eine 7 % LVS Ausstattung für Forschung mehr als in vielen anderen Bundesländern gewährt wird. Die Konkretisierung von Maßnahmen kann keine Präsidiumsaufgabe sein, sondern diese findet in den Fakultäten statt.
Die Dekanin der Fakultät Wirtschaft und Soziales, Prof. Dr. Ute Lohrentz stellte fest, dass sie die Forschungsstrategie als handlungsleitend für ihre Arbeit ansehe und gut mit den Strukturvorschlägen und avisierten Maßnahmen mitgehen könne. Aus der Erfahrung ihrer Gespräche mit den neuberufenen Professorinnen und Professoren heraus möchte sie einbringen, wie wichtig diesen immer wieder ein klares Profil der HAW Hamburg als forschende Hochschule sei und gerade dieses als attraktiv angesehen wird. Sie sieht in der Forschungsstrategie die wesentlichen Steuerungsmechanismen für Forschung gut widergespiegelt.
Präsident Teuscher stellte abschließend fest, dass die Forschungsstrategie ein wichtiger Baustein bei der Positionierung der HAW Hamburg als forschende Hochschule ist. Unter anderem benötigt die HAW Hamburg die Forschungsstrategie, um als Hochschule innerhalb der Stadt sichtbarer und erkennbar zu werden. Sie fungiert zudem als Grundlage in der Diskussion mit politischen Akteuren sowie Behörden, um die Grundfinanzierung der HAW Hamburg zu verbessern. Abschließend bedankte sich Präsident Teuscher für die kontroverse, aber ergiebige Diskussion.
Abschlussbericht der AG Leitfaden 1.0
Der Abschlussbericht der AG Leitfaden 1.0 wurde von der Tandemleitung der AG, Prof. Dr. Michaela Diener und Prof. Dr.-Ing. Thomas Netzel, vorgelegt: Zu der im Juni 2016 an das aktuelle Hamburgische Hochschulgesetz angepassten Berufungsordnung wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese AG wurde mit der Erstellung eines Leitfadens beauftragt, der Hilfestellung bei der praktischen Umsetzung der Berufungsordnung geben soll. Der Leitfaden wurde in der Hochschulsenatssitzung am 20. April 2017 unter der Maßgabe beschlossen, dass im Sommersemester 2018 eine Überprüfung auf notwendige Anpassungen und Verbesserungen erfolgt. Ein entsprechend überarbeiteter Leitfaden steht noch aus, der durch die AG Berufungsleitfaden 2.0 erstellt werden soll. In diesem Zusammenhang bedankte sich Präsident Teuscher ausdrücklich für die Arbeit von Prof. Dr. Anette Corves, die sich stark in der AG Leitfaden 1.0 engagiert hatte.
Die in der Zwischenzeit bei den Berufungsausschussvorsitzenden erfolgten Nachfragen zu der Arbeit mit dem Berufungsleitfaden führten zu dem Wunsch weiterer prozessualer Ausführungen zu Fragestellungen in den einzelnen Phasen des Berufungsverfahrens. Prof. Diener bedankte sich bei Herrn Andreas Schulz vom Personalservice für die tatkräftige Unterstützung. Dank seines Engagements wurden das Feedback geclustert, Vereinfachungen entwickelt und Musterbeispiele gesammelt, die noch formuliert werden müssen. Auf die Frage, ob es eine Planung gibt, bis wann die Arbeit abgeschlossen ist, antwortete Präsident Teuscher, dass bis Ende des Jahres die Überarbeitung des §14-Antrages abgeschlossen sein soll. Es sollen Kriterien für die Ausschreibungstexte benannt werden und unterstützende Beratung für die Berufungsausschussvorsitzenden erfolgen. Herr Teuscher bedankte sich herzlich bei der AG Leitfaden 1.0 für ihre Arbeit.
Fortschreibung des Struktur- und Entwicklungsplanes (SEP) 2016 – 2020,
Bachelor-Reform des Departments Maschinenbau und Produktion
Der Leiter des Departments Maschinenbau und Produktion, Prof. Dr.-Ing. Thomas Frischgesell, stellte das Konzept der Bachelor-Reform seines Departments vor, das im Hochschulsenat großen Anklang fand und einstimmig beschlossen wurde:
Die beiden Bachelor-Studiengänge Maschinenbau und Produktion B.Sc. und Maschinenbau und Produktion (dual) B.Sc. werden neu in den SEP 2016 – 2020 aufgenommen. Nach der Einrichtung dieser beiden Studiengänge werden drei der bestehenden Bachelor-Studiengänge des Departments aus dem SEP 2016 – 2020 gestrichen (Maschinenbau / Entwicklung und Konstruktion (incl. dualer Studienformen) B.Sc., Maschinenbau / Energie- und Anlagesysteme (incl. dualer Studienformen) B.Sc. sowie Produktionstechnik und -management (incl. dualer Studienformen) B.Sc.
Das Department Maschinenbau und Produktion (Fakultät TI) plant, die drei genannten Bachelor-Studiengänge zu einem Bachelor-Studiengang zusammenzulegen und daneben einen dualen Studiengang anzubieten. Die beiden neuen Studiengänge sollen dabei eng verschränkt werden, so dass die Studierenden im dualen Studiengang ganz überwiegend gemeinsam mit den anderen Studierenden an den Lehrveranstaltungen teilnehmen.
Neben den bereits in den bisherigen drei Studiengängen existierenden Studienrichtungen sollen weitere Studienrichtungen durch einige neue Module und Kombinationen aus bestehenden Modulen entstehen. Diese orientieren sich an den Megatrends der Automatisierung in der Produktion (Robotik), der Digitalisierung (Data Mining, Künstliche Intelligenz) und der Mobilität. Durch die Erweiterung der Wahlmöglichkeiten und Einrichtung einiger neuer Module entstehen Kombinationsmöglichkeiten, die den aktuellen Entwicklungen bezüglich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Serviceorientierung Rechnung tragen.
Zweite Lesung der Regelung zu den Forschungs- und Transferzentren in der Grundordnung und einer Mustersatzung für Competence Centren
Um die Strukturierung der Forschung in der Hochschule voranzubringen, wurden dem Hochschulsenat in seiner letzten Sitzung eine Mustersatzung für Competence Centren und der ausformulierte Vorschlag zu §18 der Grundordnung für die Forschungs- und Transferzentren (FTZs) vorgelegt. Fragen und Anregungen konnten nach der Sitzung an Kanzler Flieger geschickt werden, um die Regelungen zu überarbeiten.
Zur zweiten Lesung kündigte der Sprecher der Gruppe der Professorinnen und Professoren an, der Hochschulsenat wolle über die überarbeiteten Regelungen erst in der Mai-Sitzung abstimmen. Prof. Dr.-Ing. Thomas Flower, Dekan der Fakultät Technik und Informatik, sprach die grundsätzliche Verankerung der CCs in den Fakultäten an: Erfolgreiche CCs basierten auf den Fachlichkeiten der Fakultäten, daher sollten diese Einrichtungen auch auf Beschlüssen von Fakultätsräten basieren. Präsident Teuscher führte dazu aus, es sei nicht vorgesehen, eine Fachlichkeit an der Hochschule zu etablieren, die nicht in den Fakultäten verankert ist. Das Interesse des Präsidiums ist es, dass die existierenden CCs, die eine Bereicherung für die Hochschule darstellen, fakultätsübergreifend weitergeführt werden.
Die Dekanin der Fakultät Design, Medien und Information, Prof. Dorothea Wenzel, fragte in diesen Zusammenhang grundsätzlich nach dem Sinn einer Zweigliedrigkeit, warum müsse es CCs und FTZs geben, so dass die Gelder einmal über das Präsidium und einmal über die Fakultäten verteilt würden? Herr Teuscher versteht diese Sorge, betonte aber, dass die Freistellungen und administrative Unterstützung nach den gleichen Prinzipien vergeben werden. Das einzige Unterscheidungsmerkmal ist, dass FTZs aus den Fakultäten heraus gegründet werden und CCs über Fakultätsgrenzen hinweg. Auch eine Evaluation dieser Regelungen sei vorgesehen, sowohl intern mit dem Forschungsbeirat, in dem alle vier Fakultäten vertreten sind, als auch extern nach einem Zeitraum von vier Jahren.
Auf die Frage nach der Transparenz der Mittelverteilung für die CCs antwortete Herr Flieger, mit der neuen Lösung werde die Transparenz deutlich erhöht. Denn der Senat kann in der Mittelverteilung jährlich sehen, welche Ressourcen an die CCs fließen. Grundsätzlich gehe es bei der Regelung der FTZs und CCs um eine Satzungsfrage, die geklärt werden muss. Die Ressourcenfragen werden in den internen Ziel- und Leistungsvereinbarungen geklärt.
(Text: Ina Nachtweh)