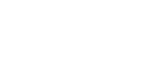Vom Kreißsaal zum Doktortitel

Dr. Thorben Schüthe in Sundsvall, Schweden. Dort hat er im Jahr 2022 den Best Student Paper Award verliehen bekommen.
„Meine schwangere Frau und ich waren mit dem Rad auf dem Weg zum Wochenmarkt, einige Erledigungen machen. Danach wollte ich weiter an meiner Präsentation für die Verteidigung meiner Dissertation arbeiten“, erinnert sich Schüthe. Diese sollte zwei Tage später an der Helmut-Schmidt Universität stattfinden. „Als meiner Frau auf dem Rad allerdings die Fruchtblase geplatzt ist, sind wir nicht auf den Markt, sondern direkt ins Krankenhaus geradelt“.
Dort gingen dann auch bald die Wehen los. Im Wehenzimmer arbeitete Schüthe noch an den letzten Folien seiner Präsentation. Kurz vor drei Uhr am nächsten Tag kam dann seine Tochter zur Welt. Zur Verteidigung seiner Doktorarbeit am Tag darauf erschien er zwar recht müde und erschöpft, seiner Leistung tat das offensichtlich keinen Abbruch – bestanden hat er mit „sehr gut“.
In seiner Doktorarbeit im Bereich Elektro- und Messtechnik - betreut von Prof. Dr. Karl-Ragmar Riemschneider - hat sich Schüthe mit magnetoresistiven Sensoren befasst. Diese werden in mechatronischen Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel in der elektrischen Servolenkung.
Schüthe erweiterte das Konzept und übertrug es auf eine Krankenhaussituation. Denn er fragte sich, wie bei Patienten, die länger künstlich beatmet werden müssen, die Position des Tubus besser überwacht werden kann. Der sogenannte Endotrachealtubus wurde ihnen unter Narkose in die Luftröhre eingeführt. Markierungen am Tubus helfen, sicherzustellen, dass er auch richtig sitzt. Dies muss regelmäßig vom Krankenhauspersonal händisch kontrolliert werden.
Meine Ergebnisse sehen recht erfolgsversprechend aus
Schüthes Idee: Ein Magnet wird innerhalb des Tubus platziert. Durch ein überwachendes Sensor-Array, also einer Anordnung mehrerer Messpunkte außerhalb des Tubus, kann dessen Position digital überprüft werden. So kann eine Verschiebung des Tubus frühzeitig und automatisiert erkannt werden. „Der Vorteil des Tunnelmagnetoresistiven Effekts, mit dem wir hier arbeiten, ist ein geringer Strombedarf gepaart mit einer höheren Sensitivität, denn das Signal muss nicht verstärkt werden“, erklärt Schüthe den Vorteil. Als Methode kommt ein so genanntes „iteratives Suchverfahren“ zum Einsatz. Dabei werden die Parameter des Modells eines Permanentmagneten variiert, bis der Fehler zwischen den berechneten und gemessenen Werten minimal ist.
„Meine Ergebnisse sehen recht erfolgsversprechend aus“, fasst Schüthe zusammen. Sie bilden eine gute Grundlage, um das Thema weiter zu beforschen. Das muss allerdings warten. Ab März ist Schüthe in Elternzeit und wird sich um seine Tochter kümmern. Besonders freut er sich auf das Babyschwimmen: „Das Planschen im warmen Wasser hat unserer Tochter großen Spaß gemacht“, erzählt er. „Das möchte ich unbedingt wieder mit ihr machen“.
Text: Tiziana Hiller
Kontakt
Dr. Thorben Schüthe
Informations- und Elektrotechnik
thorben.schuethe (at) haw-hamburg (dot) de