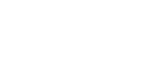Im Mittelpunkt steht eine neue Methode, nachhaltigen Wasserstoff herzustellen und dabei Kohlenstoff abzuscheiden. Das Projektteam hat eine Mikrowellen Niedertemperatur-Plasmacracking-Anlage entwickelt und am Standort der Hamburger Energienetze GmbH aufgebaut. Das Ziel: die klimafreundliche Gewinnung von Wasserstoff sowie festem Kohlenstoff (sogenanntes Carbon Black) aus Methan mittels Mikrowellenplasma. Die Inbetriebnahme der Anlage sowie der anschließende Testbetrieb zur Erforschung der neuartigen Technologie läutet die zentrale Projektphase ein.
Michael Dammann, Technischer Geschäftsführer der Hamburger Energienetze GmbH: „Mit MEDEA knüpfen wir an erfolgreiche Wasserstoff-Kooperationen wie das mySMARTLife-Förderprojekt in Bergedorf an. Erneut steht uns das CC4E mit seiner Kompetenz zur Seite, um wesentliche Erkenntnisse über eine für die entstehende Wasserstoffwirtschaft relevante Zukunftstechnologie zu gewinnen. Während wir das Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz ‚HH-WIN‘ bereits bauen, gewinnen wir so Einblicke in eine klimafreundliche Erzeugungstechnologie, die in ein paar Jahren Marktreife erlangen kann.“
Prof. Dr.-Ing. Hans Schäfers, Leiter des Competence Centers für Erneuerbare Energien und EnergieEffizienz (CC4E) der HAW Hamburg: „Die Klimakrise stellt uns vor große Herausforderungen. So werden wir zukünftig schwer vermeidbare CO₂-Emissionen vermehrt kompensieren müssen. Mit unserem Forschungsvorhaben MEDEA und der darin entwickelten Plasmacracking-Anlage kann Wasserstoff aus Biomethan zukünftig unter Abscheidung von Kohlenstoff, also CO₂-negativ produziert werden. Wegen des sehr geringen Stromverbrauchs des Plasmacrackings ist das ein vielversprechender Ansatz. Aus dem anstehenden Testbetrieb erwarten wir daher wichtige Erkenntnisse zum Betriebsverhalten, den Eigenschaften des gewonnenen Kohlenstoffs und zu betriebswirtschaftlichen Fragen einer Skalierung des Verfahrens. Wir freuen uns, dass wir hierbei unsere Projektpartner, die Hamburger Energienetze GmbH sowie die iplas GmbH an unserer Seite haben.“
Zu den Projektzielen gehört neben der Untersuchung des Anlagenbetriebs auch die Untersuchung der Produktqualitäten, der Prozessstabilität sowie der Energie- und CO₂-Bilanzen der Technologie. Auch die Abschätzung wirtschaftlicher Potenziale ist Bestandteil des Projekts und trägt damit zur Technologieentwicklung und -einschätzung im Kontext der Energiewende bei.
Einzigartige Mikrowellentechnologie ermöglicht hohen Wirkungsgrad und Skalierbarkeit
Das neuartige MEDEA Plasmacracking-Verfahren spaltet Methan in seine Bestandteile Wasserstoff und feste Kohlenstoffpartikel mit Hilfe von Mikrowellenplasma auf. Da sich der Prozess unter Ausschluss von Sauerstoff abspielt, bildet sich kein CO₂. Durch die gezielte Energieübertragung der Mikrowellenstrahlung in die Bindungen des Methans wird weniger Energie benötigt als bei alternativen Technologien wie der Dampfreformierung oder der Elektrolyse.
Die Technologie lässt sich durch die modulare Zusammenschaltung mehrerer Einheiten skalieren und kann dank der Mikrowellentechnik flexibel an- und abgefahren werden – ein Vorteil, der gerade im Hinblick auf die dynamischen Anforderungen an die Energietechnik vor dem Hintergrund des fluktuierenden Dargebots an erneuerbaren Energien an Relevanz zunimmt.
Der Aufbau der Plasmacracking-Anlage am Standort Tiefstack sowie die Anbindung an die lokale Infrastruktur haben bereits stattgefunden. Nun folgt die Inbetriebnahme der Forschungsanlage, um sie in den folgenden Monaten intensiv zu betreiben und zu untersuchen.
Forschung zum Einsatz von Biogas und der Möglichkeiten für Negativemissionen
Der Anlagentestbetrieb wird zunächst mit konventionellem Erdgas durchgeführt. Zukünftig ist jedoch geplant, das Plasmacracking mit Biomethan als Rohstoff durchzuführen. Biomethan, das vorzugsweise aus organischen Abfällen in Biogasanlagen gewonnen wird, könnte eine zentrale Rolle für negative CO₂-Emissionen spielen:
Wird der beim Plasmacracking erzeugte Kohlenstoff (das Carbon Black) langfristig gebunden und deponiert, kann er dauerhaft aus dem Kreislauf entfernt werden. Dies eröffnet das Potenzial für Negativemissionen und bietet perspektivisch die Möglichkeit, Wasserstoff zu erzeugen und zusätzlich CO₂-Zertifikate zu handeln – sobald eine rechtliche Grundlage für den Handel geschaffen ist. So könnten in Zukunft zusätzliche wirtschaftliche Anreize für die Technologie geschaffen werden.
Teilprojekt der Forschungsinitiative X-Energy mit Bundesförderung
MEDEA ist ein Teilprojekt der Forschungsinitiative X-Energy, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Zentraler Ausgangspunkt des Projektes ist der auch am Ende der Energiewende noch bestehende Bedarf nicht und/oder nur sehr schwer vermeidbarer Klimagasemissionen (z. B. aus der Landwirtschaft) dauerhaft kompensieren zu müssen. Allein für Deutschland wird dieser Bedarf an Negativemissionen auf 40 - 60 Mio. t CO₂ geschätzt. Plasmacracking von Biomethan kann helfen, diese Lücke zu schließen. Als Brückentechnologie kann sie zudem helfen den schnell steigenden Bedarf an klimafreundlich erzeugtem Wasserstoff zu decken und somit den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft unterstützen, um beispielsweise die Teile der Industrie zu dekarbonisieren, die ihre Prozesse nicht auf Strom umstellen können.