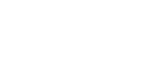Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat wegen der rasanten Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit Covid-19 den globalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Während Forscher dem neuen Erreger in Echtzeit auf der Spur sind, bereiten sich Gesundheitsbehörden, Virologen, Epidemiologen und Impfstoffentwickler weltweit auf eine mögliche Pandemie durch das Coranavirus Sars-CoV-2 vor.
Wie sieht das auf nationaler Ebene aus und wie könnte man im Krisenfall die öffentliche Kommunikation verbessern? Dazu ein Gespräch mit MD, MPH Amena Almes Ahmad, Professorin für Public Health im Department Gesundheitswissenschaften, Dr. Karsten Loer, Professor für Technik der Gefahrenabwehr im Bevölkerungsschutz und Dr.-Ing. Boris Tolg, Professor für Informatik und Mathematik mit dem Forschungsgebiet Massenanfälle von Verletzten, beide im Department Medizintechnik.
Frage: Bislang hat die Strategie der Eindämmung (containment strategy) samt Nachverfolgung der Kontakte (contact tracing) offenbar funktioniert. Aber was passiert, wenn Infizierte ohne erkennbare Symptome während der Inkubationszeit von durchschnittlich zwei Wochen in vollbesetzten Bahnen und Bussen fahren? Dann wird es wohl schwierig mit der Eindämmung?
Prof. Ahmad: Dann greift die mitigation strategy, um die Ausbreitung von Infektionen so weit wie möglich zu verlangsamen. Entsprechend standardisierter Prozesse von der WHO, dem European Centre for Disease prevention and Control (ECDC), dem Robert-Koch-Institut (RKI) und den kommunalen Gesundheitsbehörden wird die Bevölkerung allgemein über vorbeugende Maßnahmen aufgeklärt. Dafür gibt es Telefon-Hotlines und gezielte Informationen an die Medien. Diese Maßnahmen beinhalten zum Beispiel regelmäßiges und gründliches Hände waschen, die Nies- und Husten-Etikette sowie Abstand-Halten von Personen mit Erkältungssymptomen. Solche Menschen sollen sich auch nicht beim Hausarzt oder im Krankenhaus ins volle Wartezimmer setzen, sondern dort anrufen. Bei sehr hohem Patientenaufkommen wird in Krankenhäusern „triagiert“. Das heißt, eine Einstufung der Patienten nach Schweregrad wird vorgenommen, um die notwendige medizinische Hilfeleistung zu priorisieren. Dafür gibt es Protokolle.
Frage: Schwierig ist ja die anfangs unspezifische Symptomatik wie Husten, Fieber und Schnupfen. Die können sowohl auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus hindeuten als auch auf Influenza oder einen grippalen Infekt. Zur Zeit steigt in Deutschland die Zahl der Influenza-Fälle. Außerdem hatten wir schon vorher eine Debatte über Kapazitätsgrenzen in Krankenhäusern, Lieferengpässe bei Medikamenten und Mangel an Pflegekräften. Wie kann man vor diesem Hintergrund eine mögliche Pandemie in den Griff bekommen?
Prof. Ahmad: Also, erst einmal muß man sagen, dass Deutschland mit seiner Krankenhauskapazität relativ gut aufgestellt ist. Hierzulande gibt es zirka acht Betten pro tausend Einwohner. Das ist mehr als in anderen europäischen Ländern. Im Notfall muss dann auch schnell Kapazitäten für die schweren Fälle bereitgestellt werden, also Plätze auf der Intensivstation und Beatmungsgeräte für Patienten mit schwerer Lungenentzündung. Aber nicht jeder Infizierte wird ein schwerer Fall. Das ist eher die Minderheit.
Prof. Tolg: Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll, für ein seltenes Ereignis wie eine Pandemie dauerhaft große Kapazitäten vorzuhalten. Die Strategie lautet stattdessen: Selbst-Quarantäne für die leichteren Verläufe, mit telefonischem Kontakt zum Arzt für die Betreuung. Die Krankenhaus-Betten sind dann für die Patienten da, die intensiv-medizinische Versorgung brauchen (siehe Nationaler Pandemieplan Teil II, RKI).
Frage: Wie sollte eine möglicherweise bevorstehende Pandemie in der Öffentlichkeit kommuniziert werden, ohne Panikmache und ohne Verharmlosung?
Prof. Ahmad: Klare Kommunikation ist wichtig. Auch, wenn es hier zu schlimmeren Fällen kommen sollte, muss man das offen und transparent erklären. Man sollte nicht mit gesicherten Informationen hinterm Berg halten, das würde nur Misstrauen hervorrufen. Für eine klare Kommunikation brauchen wir Medienexperten, also Leute, die in der Lage sind, die Fachsprache der Wissenschaftler für die Bevölkerung zu übersetzen. Man könnte zum Beispiel im Fernsehen vor den Abendnachrichten einen Informationsclip senden, um die wichtigsten Informationen an ein breites Publikum weiter zu leiten.
Prof. Loer: Risikokommunikation ist auf jeden Fall wichtig, also fundierte Information und Verhaltensregeln zu vermitteln, ohne Panik zu schüren. Für eine solche Aufklärung kann man auch die Sozialen Medien gut nutzen. Zusätzlich kann die Auswertung der öffentlichen Kommunikation über soziale Medien zum Beispiel mit Hilfe künstlicher Intelligenz helfen, frühzeitig Hinweise auf mögliche regionale Ausbrüche zu erhalten.
Prof. Ahmad: Man könnte zum Beispiel eine App entwickeln, so wie es im Rahmen unseres europäischen Forschungsprojektes „Effective Communication in outbreak management“, kurz E-com schon umgesetzt wurde. Mit der in diesem Projekt entwickelten App könnten dem Nutzer anhand seiner GPS-Daten eine Reihe wichtiger Informationen angezeigt werden. Etwa welche Ärzte und Krankenhäuser es in seiner Nähe gibt, wie die Nummer der zuständigen Telefon-Hotline lautet, wieviele Infizierte es bereits in seiner Umgebung gibt und gegebenenfalls, wo man sich impfen lassen kann. Wenn dann beispielsweise das Bundesgesundheitsministerium so eine App mit Informationen befüllt, dann weiß man wenigstens: das ist die offizielle Version.
Frage: Können Sie kurz darstellen, worum es bei „E-com“ ging?
Prof. Ahmad: Das internationale Projekt E-com wurde von der Europäischen Union mit dem Ziel gefördert, die öffentliche Kommunikation im Fall einer Pandemie in Europa zu verbessern. Die Untersuchung basierte auf der 2009 grassierenden Schweine-Grippe, anhand derer man erprobt hat, wie man die Bevölkerung über Risiken und Schutzmaßnahmen aufklären kann. Dafür wurden epidemiologische Daten, Medienberichte, sowie die Meinungen von Experten und der Bevölkerung analysiert. Damals kooperierten Forschungseinrichtungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen aus den Niederlanden, Großbritannien, USA und Deutschland miteinander. Auch Prof. Dr. Ralf Reintjes – Professor an der HAW für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung – und ich haben daran mitgearbeitet.
Frage: Wenn so eine App bereits existiert, warum wird sie denn nicht eingesetzt?
Prof. Ahmad: Bisher gab es glücklicherweise kein Ereignis, dass den Einsatz erfordert hätte. Zudem muss die App regelmäßig mit aktuellen Daten versorgt werden, um sie für die Bevölkerung relevant zu machen und die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Außerdem existiert eine Vielzahl an unterschiedlichen Apps, sodass es schwer ist, das gezielte Interesse der Bevölkerung auf eine App zu lenken.
Frage: … dazu gehören ja auch „KatWarn“ und „Nina“. Diese Apps könnte man doch ebenfalls mit Informationen zum Corona-Virus füttern?
Prof. Loer: Die Herausforderung ist allerdings, dass nur rund fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung diese Apps auf dem Smartphone haben. Sie sind nicht sehr bekannt. Dafür müsste man wohl erstmal Werbung machen.
Frage: Das könnte man doch vor den Nachrichten machen?
Prof. Tolg: Klar. Wir haben allerdings in Deutschland keinen Social-Media-Kanal, der über eine mediale Aufmerksamkeit verfügt, wie beispielsweise der Twitterkanal von US-Präsident Trump. Hätte man eine App mit einer vergleichbaren Sichtbarkeit, könnte man diese natürlich auch für eine klare Risiko-Kommunikation nutzen. Man braucht einfach einen Weg zur kurzen, sachlichen und übersichtlichen Information.
Frage: Also, unsere Politiker leiden ja nicht gerade unter Twitter-Mangel. Aber das ist eben oft selbstreferenziell...
Prof. Tolg: Ja, das könnte man besser machen.
Prof. Loer: Bei der Ausbildung unserer Studierenden der Gefahrenabwehr und des Rettungsingenieurwesens ist das Thema Krisenmanagement und Risikokommunikation ein wesentlicher Bestandteil. Die Risikokommunikation wird dabei sowohl von technischer, als auch von inhaltlicher Seite betrachtet.
Prof. Ahmad: Im Wintersemester 2020/2021 wird im Rahmen des Competence Center Gesundheit (CCG) am Campus Bergedorf eine Ringvorlesung über das Auftreten von Infektionskrankheiten veranstaltet. Hierbei wird es neben Themen wie den Ursachen globaler Verbreitung von Erregern, epidemiologischer Detektivarbeit sowie der Rolle der Kommunikation bei Krankheitsausbrüchen auch um die Herausforderungen neuartiger Erkrankungen wie Covid-19 gehen. Nähere Informationen zu den Inhalten und Terminen werden über das CCG bekannt gegeben.
(Das Gespräch führte die Wissenschaftsjournalistin Monika Rößiger, Redaktion Dr. Katharina Jeorgakopulos)