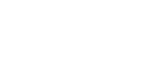"Die Wahrnehmung des gesamten gebauten Raumes, das Verhalten in Gebäuden, das Entwerfen und Bauen von Gebäuden, kurz das architektonische Denken und Handeln, werden von den sich über Jahrhunderte entwickelnden Machtverhältnissen zwischen den Klassen und den Geschlechtern geprägt". Deshalb ist es Ziel der Untersuchung, die Veränderungen der Verhältnisse zwischen Mann und Frau sowie deren Auswirkungen auf Architektur und Nutzung der Räume im Verlauf des Zivilisationsprozesses vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart darzustellen.
Adelsbeziehungen und Architektur
Von der höfischen Gesellschaft Ludwigs XIV. über das Erste Deutsche Reich und den Nationalsozialismus bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts reicht die Analyse von Prof. Dr. Katharina Weresch. In den Adelsfamilien zur Zeit des Sonnenkönigs hatten Frauen und Männer ein anderes Verhältnis zueinander als heutzutage. Die Damen der Gesellschaft wurden als Repräsentantinnen der Familie respektiert und übernahmen keinerlei Haushaltspflichten. "Die adelige Eheschließung diente der Fortführung des Ranges und des Prestiges der alteingesessenen Adelsgeschlechter durch einen neuen, standesgemäßen Repräsentanten - der Frau. (…) Die Beziehung der Eheleute wurde definiert durch die Repräsentation ihres "Hauses". Die adlige Beziehung der Eheleute war im Vergleich mit der bürgerlich gleichrangiger, mit weniger Über - und Unterordnung." Dementsprechend präsentierte sich auch die Architektur: Schlösser und adlige Stadthäuser hatten zwei nahezu identische Flügel zu beiden Seiten des Hofes, "eines für den Herrn und eines für die Dame, mit eigenen Zugängen über getrennte Treppenhäuser. (…) Die Schlafzimmer lagen einander gegenüber, getrennt durch die Hofbreite, die Fenster kontrollierten sich jedoch nicht gegenseitig, sie lagen zur anderen Seite."
Wie das Kochen lag auch die Kindererziehung in Adelskreisen in Händen der Bediensteten. "Kinder waren die zukünftigen Repräsentanten des Ranges und Standes. Sie wurden wie kleine Erwachsene behandelt, bei der Kleidung und der Darstellung der zukünftigen Rolle. Sie lebten räumlich völlig getrennt von den Eltern, sie bewohnten eigene Flügel im Schloss, benutzten ganz normale Erwachsenenmöbel und wurden von Ammen und Gouvernanten betreut."
Das zweite Deutsche Reich (1871 – 1914)
Die bürgerliche Gesellschaft im zweiten Deutschen Reich ahmte die adligen Sitten Frankreichs nach. Dies äußerte sich natürlich auch in der Architektur. Allerdings überlebte das führende Bürgertum nur durch Arbeit. Es "trennte ihre Funktionen, in von den Männern ausgeübtes Berufsleben zum Gelderwerb und der Erhöhung der gesellschaftlichen Position und in von Frauen geführtes Privatleben zur Repräsentation, Regeneration und Muße, wie im adligen Vorbild." Die Kinderbetreuung lag weiterhin bei den Erzieherinnen; das Personal übernahm die übrigen Haushaltspflichten. "Die Appartements für den Herrn und für die Dame waren räumlich identisch und lagen symmetrisch an der Eingangsfront, jedoch spiegelte die Nutzung schon die typischen Familienbeziehungen des Bürgertums, mit der Arbeitsteilung in Berufsleben der Männer und dem innerhäuslichem Privatleben der Frauen zur Repräsentation des Status. (…) Kleine Kinder durften Gesellschaftsräume unaufgefordert nicht betreten, nur zur Vorstellung von Gästen bei repräsentativen Anlässen."
Die Industrialisierung verändert die (Wohn-)Welt
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde die Produktion von Gütern immer wichtiger und die gleichberechtigte Beziehung von Mann und Frau verschlechterte sich für die Damen. Die "Vorstellung von persönlicher Abhängigkeit der Frau" zeigte sich anhand der veränderten Raumverteilung: "Der 'Eingang der Villa (rückt) an eine Seite des Hauses, womit die Zimmer der Frau... bewacht' und kontrolliert hinter denen des Herrn liegen." Die Rolle der Frau verschlechterte sich weiter, als die Haushaltsangestellten zu den besser bezahlten Arbeitsplätzen in die Fabriken abwanderten. Viele Familien konnten sich aufgrund der Knappheit der Bediensteten diese nicht mehr leisten. Die Frauen, die bisher nie mit Haushaltspflichten betraut waren, mussten deshalb immer mehr diese Aufgaben übernehmen. Die Küchen rückten vom Keller in das Erdgeschoss in die Nähe des Damenzimmers.
Im Gegensatz zur immer noch großzügigen Wohnsituation des Bürgertums "hausten [die Menschen der Arbeiterklasse] größtenteils unter unmenschlichen Bedingungen in unhygienischen Wohnungen, teilweise bis zu 20 Personen pro Raum.
Für die Industriearbeiterschaft bedeuteten sowohl Frauen als auch Kinder notwendige Arbeitskräfte. Eine zweite Arbeitsfunktion der Frauen bestand im Gebären von bis zu 15 Kindern." Kinderzimmer gab es allerdings nicht. "Das gesamte Leben mehrerer Personen fand in den Arbeits-Küchen-Wohn-Schlafstuben statt, die in Berlin knapp 50% des Gesamtwohnraumes betrugen." Es gab kaum Teilräume für einzelne Personen, so dass alle Tätigkeiten vor den Augen der Familienmitglieder, die mehreren Generationen angehörten, verrichtet wurden.
Wohnen in den 20er Jahren
Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde der Adel entmachtet und das Bürgertum rückte nach. "Infolge dieser Machtverschiebung verschärfte sich die Trennung zwischen dem geldverdienenden und geldvermehrenden Mann außer Haus und der hausführenden Frau innerhalb des Hauses." Die Damenzimmer wurden aufgelöst, ebenso Musikzimmer, Bibliothek etc. Dafür gab es einen großen Raum, der in Zonen möbliert war, die die jeweiligen Funktionen übernahmen. In dieser "Repräsentationsetage" arbeitete der Mann zeitweise, weshalb Klavierspiel oder Kindergeschrei verboten und leises Sprechen geboten waren, um nicht zu stören. Die Männer erhielten somit die Möglichkeit, mehr über die Familie zu wachen, wenn sie zu Hause waren.
Die Industriearbeiter bekamen durch die neue Regierung sogenannte Kleinsiedlungen am Rande der Stadt, "wie die Siedlung in Praunheim bei Frankfurt von Ernst May 1927". Um für die Frau die Hausarbeit nach dem Fabrikjob zu erleichtern, entwarf Grete Schütte-Lihotzky die berühmte Frankfurter Küche, die gerade 6,5 qm groß ist. "Auch wenn nun die Arbeiterfrauen ebenso wie die Männer in den Fabriken arbeiteten, dachten die Arbeitermänner in keinster Weise daran in der Küche zu arbeiten, denn Küchenarbeit bzw. Frauenarbeit galt als die minderwertigere."
Der größte Raum war das Wohnzimmer an der Gartenseite und die Kinderzimmer befanden sich nach großbürgerlichem Vorbild im ersten Obergeschoss.
Nachkriegszeit
Die komplette Entwicklung der Architektur während der Hitlerzeit wird in dem Bericht aufgrund ihres Umfanges nicht behandelt. "Angemerkt werden soll, dass das von Hitler definierte Geschlechterverhältnis in das Baustandardwerk des Hochschulprofessors Ernst Neufert 1936 eingeflossen ist. Im Sinne des nationalsozialistischen Idealbildes finden wir klare geschlechtsspezifische Rollenteilungen und Tätigkeitszuordnungen, die den etablierten staatlichen Machtpositionen entsprechen."
Nach dem Zweiten Weltkrieg verbesserten sich die Vermögensverhältnisse der Bürger. Im Jahre "1957 entstand die erste DIN Norm 18022, die gesetzliche Vorschrift für den sozialen Wohnungsbau über Stellflächen, Raumbedarfe und Zuordnungen der Räume, sowie eine exakte Verortung der stattfindenden Nutzungen, aktualisiert 1967, bis heute gültig." An dem Aufbau der Wohnung änderte sich wenig. Die Frankfurter Küche überlebte ebenso wie das Wohnzimmer als größter Raum mit bester Lage und teuren Möbeln. Obwohl die Häuser immer größer wurden, blieben die Kinderzimmer und die Küchen klein, so dass darin nicht viel gespielt werden konnte.
Die 68er Generation veränderte einiges: Sie "lehnte die bürgerlich repräsentierenden Lebensweisen, die geschlechterrollenorientierte Kleinfamilie und die sogenannte autoritäre Erziehung ab. (…) Die daraus entstehenden selbstinitiierten Wohnprojekte wiesen in allen Raumbereichen gegensätzliche Konzeptionen zu den bürgerlichen Grundrissen des herkömmlichen Wohnungsbaus auf." Nun war der zentrale Raum eher eine "Art Ess-Küchen-Aufenthalt-Dielentyp", welche die Kontrolle der Kinder im Spielhof ermöglichte.
Wohnen am Ende des 19. Jahrhunderts
Die Architektur der 68er konnte z. T. Einzug halten in die 80er Jahre. Wohnküchen wurden populärer, sogar im Bürgertum. Ebenso erhielten die Kinder größere Zimmer, mit Balkon und eigenem Zugang über das Treppenhaus, um sich im Jugendalter zurückziehen zu können.
"Die größte und wichtigste Veränderung in den vergangenen 50 Jahren geht von der kontinuierlich zunehmenden Berufstätigkeit der Frauen aus." Frauen entscheiden sich hierbei immer häufiger gegen Ehe und Kinder. Männer nehmen mehr Teil an der Kindererziehung. Da der Wohnungsbau der 60er und 70er Jahre diesen veränderten Ansprüchen nicht genügte, entwickelte sich der Wohnungsbau in den 90er Jahren in mehrere architektonische Richtungen. Die Räume sollten größer wirken - z. B. durch Schiebeelemente - und die Bedürfnisse der Frauen wurden in der Architektur mehr berücksichtigt. Allerdings: "Eine von der Verfasserin erstellte Untersuchung von veröffentlichten Wohnungsgrundrissen aus der Deutschen Bauzeitschrift von 1995 – 2000 zeigt, dass trotz aller gesellschaftlichen Wandlungen und trotz der funktionalen Verbesserungen der Arbeitsprozesse in der Wohnküche, die meisten Architekten nach wie vor 'Arbeitsküchen' bauen, die kaum größer sind als die Frankfurter Küche für Arbeiterfrauen von 1927."
Eine der Schlussfolgerungen lautet deshalb: "Die Geschlechter haben sich in ihren Tätigkeiten und Verhaltensweisen im Verlauf der letzten 100 Jahre einander angenähert. Männer übernehmen heute 'weibliche' Verhaltensanteile wie Kindererziehung, während Frauen in die Berufswelt eindringen und 'männliche' Verhaltensformen wie Karriereorientierung übernehmen. Das bedeutet für den Wohnungsbau etwas in der Geschichte Neues und Einmaliges und enthält die Aufforderung an die Architektur, an der Erstellung von Räumen zu arbeiten, in denen gleichzeitig von beiden Geschlechtern beide Verhaltensanteile gelebt werden können. Leider wird dies bisher nicht umfassend genug praktiziert."