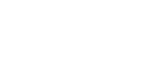Wenn ich im Supermarkt stehe, fühle ich mich oft überfordert: Bio, Fairtrade, Ampel, hohe Preise, Herkunftsland, Verpackung – so viele Faktoren fließen in meine persönliche Kaufentscheidung ein. Wie können wir als Verbraucher*innen besser geleitet werden, hin zu nachhaltigerem Konsum?
Unser Ernährungsverhalten wird durch zwei Systeme gesteuert: einem reflexiven und einem impulsiven System. Mit dem reflexiven System planen, evaluieren und entscheiden wir, während wir mit dem impulsiven System relativ automatisch auf Reize in unserer Umwelt reagieren. Der Supermarkt ist ein Ort, an dem uns sehr viele verschiedene Reize begegnen. Wir sehen und riechen verschiedene Lebensmittel, das spricht unser impulsives System an. Zugleich finden wir visuelle Informationen in Form von Labeln oder Preisen, was unser reflexives System anspricht. Da beide Systeme gleichzeitig agieren, ist es schwer für uns, im Supermarkt immer unseren eigenen Zielen, Einstellungen und Standards zu folgen. Wir kennen es alle, dass uns beispielsweise jetzt vor Ostern kurz nach dem Obst und Gemüse oder vor der Kasse als Störer große Aufsteller mit Schokoladenosterhasen begegnen. Das stellt uns alle vor die Wahl, noch kurz einen Schokohasen mitzunehmen, auch wenn wir gar nicht vor hatten, einen zu kaufen. Es gibt daher auf Ihre Frage, wie wir Verbraucher*innen besser geleitet werden können, keine einfache Antwort. Denn gleichzeitig haben wir heute die Freiheit, die eigene Ernährung nach Belieben zu gestalten. Ebenso sind Lebensmittel gemessen am Einkommen trotz Inflation immer noch sehr günstig. Das heißt: Unsere Ernährung ist nicht, wie noch vor ein paar Jahrzehnten stark durch Verfügbarkeit und soziale Normen geregelt.
Der Nutri-Score hilft uns, schnell die Produkte innerhalb einer Gruppe zu vergleichen, beispielweise unterschiedliche Tiefkühl-Pizzen. Wer aber Bluthochdruck hat, muss genauer hinschauen und die Nährwertkennzeichnung lesen. Ernährungswissen hilft den Betroffenen dann, die richtige Entscheidung zu treffen. Um Verbraucher*innen zu helfen, nachhaltig zu konsumieren, muss das Verständnis gefördert werden, was eine nachhaltige Ernährung beinhaltet. Wir brauchen Möglichkeiten nachhaltige Produkte auszuwählen sowie uns zu informieren, um uns für ein nachhaltigeres Produkt – beispielsweise ein saisonales, regionales oder Bio-Lebensmittel – zu entscheiden.
Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich in Sachen nachhaltige Ernährung und wo sehen Sie noch Baustellen und Handlungsbedarf?
Deutschland hat sich als Teil der Europäischen Union auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Vereinten Nationen verständigt. In dieser wurden 17 Ziele beschlossen: die sogenannten Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Den Zielen wurden verschiedene Unterziele zugeordnet, die je nach Land und Region spezifiziert werden können. So gibt es sowohl eine europäische Nachhaltigkeitsstrategie, die den Mitgliedsstaaten wesentliche Maßnahmen zum Umbau ihres Ernährungssystems empfiehlt. Ein bekanntes Beispiel ist die Aufforderung, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und Lebensmittelabfälle zu reduzieren.
Es gibt zudem die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die 2002 entwickelt wurde und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die Berichte zum Stand der Umsetzung dieser Strategien in Deutschland liefern Anhaltspunkte dazu, wo Deutschland in Sachen nachhaltige Ernährung steht.
Schauen wir beispielsweise auf das SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“: Für die meisten Indikatoren des Ziels ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Allerdings sind bei der Adipositasquote und der vorzeitigen Sterblichkeit bei Frauen und Männern kaum oder keine Fortschritte zu sehen. Daran wird deutlich, dass wir bei der Prävention von Übergewicht und der Gestaltung von fairen Ernährungsumgebungen noch Herausforderungen haben.
Aber auch in Bezug auf das SDG 1 „Keine Armut“ haben wir Handlungsbedarf: 2023 waren in Deutschland 23,9 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, womit Deutschland lediglich im europäischen Mittelfeld liegt.
Daneben haben wir noch einige weitere Herausforderungen zu meistern: So ist beispielsweise bei den Zielen zum "Ökologischen Landbau", "Nitrat im Grundwasser" oder "Anteil der nachhaltig befischten Fischbestände in Nord- und Ostsee" damit zu rechnen, dass diese bis 2030 nicht erreicht werden.
Ernährung ist eine sehr individuelle Angelegenheit: Jede*r darf für sich selbst entscheiden, wann sie oder er etwas kaufen und essen möchte. Das klingt selbstbestimmt. Die Forschung widerspricht dem und bringt den Begriff „Ernährungsumgebung“ ins Spiel. Diese soll unsere Ernährung mehr beeinflussen als wir wahrhaben möchten.
Gehen wir gedanklich nochmal zurück zur Situation im Supermarkt. Sie hatten schon angesprochen, dass es je nachdem, was Sie kaufen wollen, schwierig ist, nachhaltige Alternativen zu erkennen. Oft haben Sie die Wahl zwischen sehr vielen verschiedenen Produkten. Aus der Forschung der Ernährungspsychologen wissen wir, dass es zu Unzufriedenheit führt, wenn zusätzlich die Auswahlaufgabe schwierig ist, also wenn Sie zum Beispiel noch nicht entschieden haben, was Sie zum Abendessen möchten.
Zusätzlich nutzt der Handel Erkenntnisse aus der Verhaltenspsychologie für sich und setzt uns bewusst Reizen aus, die unser impulsives System ansprechen. So sind im Handel günstige Marken oder auch Bioprodukte nicht immer auf Augenhöhe zu finden, sondern unten im Regal. Oder uns begleiten verschiedene Gerüche durch den Markt zum Beispiel der Geruch nach frischgebackenen Brötchen. Auch wird unser Weg durch Aktionsware wie Osterhasen gestört und unsere Aufmerksamkeit auf diese Produkte gelenkt. Ein Supermarkt ist so gestaltet, dass wir möglichst viel einkaufen und nicht so, dass wir zu den nachhaltigen Produkten zuerst greifen.
Wenn wir nun von fairen Ernährungsumgebungen sprechen, dann meinen wir in der Forschung eine Umgebung, die auf unsere menschlichen Wahrnehmungs- und Entscheidungsmöglichkeiten sowie Verhaltensweisen abgestimmt ist und uns damit eine nachhaltigere Ernährung im Alltag einfacher ermöglicht. Sprich: die nachhaltige Wahl zu einer einfachen Wahl macht.