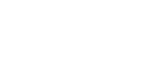Am Beispiel der Fachkräftemigration stellen die Vorträge der Ringvorlesung dar, entlang welcher Widersprüche die deutsche und europäische Migrationspolitik gestaltet wird und welche Auswirkungen das jeweils regional, in nationalen Kontexten und auch global hat: Einerseits wird angesichts des demografischen Wandels aktiv nach Fachkräften aus dem Ausland geworben. Andererseits erschweren strukturelle Hürden und diskriminierende Narrative vielen bereits hier lebenden Migrant*innen – insbesondere Geflüchteten – den Zugang zum Arbeitsmarkt. Die gegenwärtige Trennung in „nützliche“ und „unnütze“ Migrant*innen verstellt den Blick auf tatsächliche Kompetenzen und fördert Stigmatisierung. Statt punktueller Maßnahmen braucht es eine umfassende, institutionell verankerte Offenheit.
Professor Seukwa, könnten Sie erst einmal ein bisschen was zu den Hintergründen der diesjährigen Vortragsreihe erzählen? Warum finden Sie das Thema wichtig?
Prof. Dr. Louis Henri Seukwa: Die deutsche Migrationspolitik ist in sich sehr widersprüchlich: Auf der einen Seite werden die symbolischen und physischen Grenzen hochgezogen. Bestimmte Migrationsformen und bestimmte Gruppen von Migrant*innen sollen mit immer restriktiveren Methoden wie fragwürdige Abkommen mit sogenannten sicheren Drittstaaten, die als Türsteher Europas dienen, entweder an der Einreise gehindert oder so schnell wie möglich wieder ausgewiesen oder abgeschoben werden. Dies vermeintlich zur Wahrung nationaler Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen. Auf der anderen Seite ist die Rede vom demografischen Wandel und Fachkräftemangel. Es werden bilaterale Verträge zur Anwerbung von hochqualifizierten Menschen aus ausgewählten Ländern des globalen Südens geschlossen, während den Flucht-Migrant*innen, die sich bereits hier aufhalten, der Weg in den Arbeitsmarkt unnötig schwer gemacht wird. Das hat nationale sowie globale Konsequenzen – nicht nur für die Individuen, sondern auch für die wirtschaftlichen und politischen Systeme bzw. die jeweiligen Gesellschaften. Diese komplexen Zusammenhänge und Widersprüche werden in der Regel nicht offen genug kommuniziert. Die Ringvorlesung soll hier einen Beitrag leisten und das Thema Fachkräftemigration aus möglichst verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Würden Sie sagen, dass in Deutschland der Umgang mit ausländischen Fachkräften, die schon hier sind, problematisch ist?
Louis Henri Seukwa: Ja, leider. Es gibt zwar schon ein paar gute Ansätze, aber die eben erwähnten Widersprüche setzen sich auch hier fort. Wir denken sehr lokal. Wir denken sehr eurozentrisch. Wir denken nationalistisch. Denn wir erkennen erst einmal nur uns selbst ergo auch unsere Qualifikationen, Produkte, Arbeitskultur etc. als wertvoll und wir neigen dazu, alles andere zu entwerten, nicht anzuerkennen. Es ist aber so, dass nationales Denken für eine global orientierte Marktlage einfach kurzsichtig und ruinös ist. Alle EU-Länder und vor allem Deutschland, dessen Wirtschaft sehr exportorientiert ist, wollen einen offenen globalen Markt. Aber um so einen Markt zu bedienen, müssen u.a. die Bildungsinstitutionen hierzulande in der Lage sein, Menschen zu bilden, die genau solche global orientierten Mindsets haben, also Politiker*innen, Wirtschaftsakteure, Unternehmer*innen, Mitarbeitende und so weiter. Effektive Offenheit ist hier notwendig. Das heißt auch eurozentristisches bzw. nationalchauvinistisches Denken sind als Hindernisse für die Verwirklichung dessen zu sehen. Ich argumentiere hier wohlgemerkt bewusst nicht normativ. Mein Plädoyer für eine effektive Offenheit hat also nichts mit Nächstenliebe, moralischer Verantwortung für die ganze Welt, Entwicklungshilfe oder dergleichen zu tun. Ich bleibe strictus sensus in der Markt- und Eigeneinteresselogik, um festzustellen, dass wir diskursiv und integrationspolitisch nicht ständig einen Antimigrationskurs fahren können, der den Aufstieg von Rechtsradikalismus befeuert und dem Ansehen des Landes über die europäische Grenze hinweg schadet und zugleich glauben, dass wir im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe erfolgreich sein können. Es ist evident, dass die migrationsfeindliche Kultur und der damit einhergehende wachsende Rechtspopulismus Deutschland für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland sowie für Flucht-Migrant*innen, die schon hier anwesend sind, immer unattraktiver macht.
Wo könnten Verbesserungen ansetzen?
Louis Henri Seukwa: Ich denke wir müssen grundsätzlich zunächst zugeben, dass der aktuelle migrationspolitische Kurs Deutschlands mit Blick auf die Herausforderungen des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels höchstproblematisch und nicht zielführend ist. Wir brauchen das, was ich effektive Offenheit genannt habe: Eine Programmatik, welche institutionell und kulturell in alle gesellschaftlichen Subsysteme implementiert werden soll, mit dem Ziel gesetzlich, diskursiv und praktisch in der deutschen Gesellschaft Migration nicht mehr als Bedrohung zu betrachten bzw. nicht mehr mit defizitärem Blick zu sehen.
Dies bedeutet beispielsweise, dass mit solchen Anachronismen aufgehört wird, welche kategoriell erwünschte qualifizierte Mitgrant*innen als Gegensatz zu unerwünschten nutzlosen Fluchtmigrant*innen darstellt. „Flüchtling“ ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern lediglich ein legaler Status, der auf eine bestimmte Normierung von Mobilität im Aufnahmeland fußt und somit weder über die Kompetenzen noch über die Qualifikationen eines Menschen etwas zu sagen hat. Dieser manichäische Diskurs bewirkt jedoch in der kollektiven Vorstellung – allen empirischen Evidenzen zum Trotz –den Eindruck, dass „Flüchtlinge“ nur eine Last oder ein Problem für die Gesellschaft sind. Dieser Eindruck ist verheerend, weil er nicht nur zu den kollektiven Stigmatisierungen mit erheblichen diskriminierenden Effekten auf Fluchtmigrant*innen, die als bedürftig, inkompetent, unqualifiziert, kriminell gesehen werden, führt, sondern auch die Konstruktion eines des barmherzigen Helfers und Flüchtlingsretters ermöglicht. Dies blendet u.a. die Verstrickung der Länder des Nordens in der weltweiten Produktion von Fluchtursachen aus und hindert auch die Wahrnehmung von Fluchtmigrant*innen als Menschen mit Kompetenzen und (hohen) Qualifikationen.
Mit Blick auf Hochschule bedeutet die effektive Offenheit, die Erkennung und Anerkennung der von Fluchtmigrant*innen mitgebrachten Kompetenzen und diese somit als Ressourcen für ihre schnelle Bildungserfolge sowie ihre berufliche Eingliederung nutzbar zu machen. Dieser Ressourcenansatz soll insbesondere auf drei Strukturmomente der institutionellen Bildungsbiografien bezogen und berücksichtigt werden: Zugang, Verbleib und Erfolge/ beruflicher Übergang. Bei der Implementierung sollen entstehende Irritationen als Impuls genutzt werden, um die effektive Offenheit hochschulstrukturell zu verankern und die Hochschulinstitution somit fit für den globalen Wettbewerb um die Akquise von internationalen Akademiker*innen zu machen. Nur so kann meines Erachtens die Hochschule von den Phänomenen der Migration und den damit einhergehenden Anforderungen für nationalstaatlich gewachsene Institutionen nachhaltig profitieren.
Lieber Herr Prof. Seukwa, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Lotta Winkler