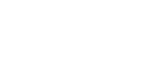078-Fertigungstechniklabor
Die Episode
Transkript
Es ist Zeit für ein wenig Fertigungstechniklabor, so heißt es bei uns für Studierende im dritten Semester im Studienplan. Labor – Das klingt irgendwie nach gekachelten Wänden und weißen Kitteln. Das ist bei uns aber nicht so. Die Laborversuche (ich mag die in unserem englischsprachigen Studiengang verwendete Bezeichnung „practical sessions“ tatsächlich lieber) finden bei uns in Werkstätten statt. Mit Maschinen. Echten Maschinen.
Aber zurück zum Anfang: Das HAW in HAW Hamburg steht für „Hochschule für angewandte Wissenschaften“. Und es ist egal, in welchen Studiengang man hineinschaut, das „angewandt“ wird großgeschrieben. In „Textildesign“ werden Stoffe gewebt, in „Soziale Arbeit“ wird eine Obdachlosenunterkunft betreut, in Informatik wird der „Living Place“ mit smarter Technologie versehen.
Zu fast jeder Vorlesung gehört eine Praxiseinheit und die wird halt üblicherweise als Labor bezeichnet. Na gut! Bei Mathe heißt es Übung und man rechnet Aufgaben. Ausnahmen…
Wenn man also im Bachelorstudiengang „Maschinenbau und Produktion“ im zweiten Semester die Fertigungstechnik-Vorlesung gehört hat, dann steht im dritten Semester das Fertigungstechnik-Labor an. Das bedeutet, dass die Student:innen nach einer Einführung und einer Sicherheitsunterweisung alle zwei Wochen für 3 Zeitstunden zu uns in die Werkstatt kommen und dort vertiefende Versuche machen. Einen Großteil macht dabei die CNC-Prozesskette aus.
An diesen Terminen wird die Produktion eines Bauteils entweder mit Fokus auf unser 5-Achs-Fräsbearbeitungszentrum oder mit Fokus auf das Drehbearbeitungszentrum mit angetriebenen Werkzeugen durchgegangen. Die Studierenden modellieren ein Bauteil nach Skizze im 3D-CAD, erstellen einen Schnitt- und Technologieplan, dann folgt die Prüfung der Machbarkeit z. B. durch die Berechnung der notwendigen Maschinenleistung oder der Kippmomente bei der Aufspannung. Das Wissen dafür kommt aus der Vorlesung. Darauf folgt die Programmierung mittels werkstattorientierter Programmierung. Dann geht es an die Maschinen. Wir haben im Labor zwei Bearbeitungszentren stehen, die in genau dieser Ausführung auch in Fertigungsbetrieben stehen könnten. Es sind keine speziell hergestellten Demonstratoren für die Lehre. Ja, in einigen Unternehmen sind die Maschinen vielleicht etwas größer, aber man muss bedenken, dass wir in der Lehre keine echte Wertschöpfung betreiben. Und die meisten Maschinen bei uns sind auch nicht aus Drittmitteln der Forschungsvorhaben bezahlt. Die Steuerungen sind aktuell und auch Zusatzeinrichtungen wie Messtaster oder Minimalmengenschmierung fehlen nicht.
Last but not least werden die an der Maschine gefertigten Bauteile dann auch einer Qualitätsprüfung unterzogen. Dies passiert an unserer Koordinatenmessmaschine, die ebenfalls von den Studierenden programmiert und bedient wird. Wir suchen den Mikrometer.
Neben der CNC-Zerspanung haben wir auch Versuche zur Umformtechnik. Dazu haben wir im Labor zwei Hydraulikpressen mit 25 bzw. 100t und eine Reibspindelpresse mit 400t Presskraftäquivalent. Darauf laufen z. B. Stauch- und Tiefziehversuche.
Damit wir auch die Urformtechnik anfassbar machen können, haben wir eine Vakuumgießanlage und einen Sinterofen. Die Grünlinge für die Pulvermetallurgie erzeugen wir mit der großen Hydraulikpresse.
Für die Zerspankraftmessung haben wir eine große konventionelle Drehmaschine mit 3-achsigem Kraftmesstisch. Die additive Fertigung wird auch in einem Versuch betrachtet. Und last but not least haben wir auch noch die Funkenerosionsanlage zum Senkerodieren mit Kupfer- oder Graphitelektroden.
Wie läuft das ganze dann ab: Im Laborplan können die Studierenden herausfinden, an welchem Tag welcher Versuch ansteht. Dazu gibt es auf der Lernplattform Versuchsbeschreibungen zum Download. Darin finden die Studierenden die Aufgabe, Quellenangaben, Formeln, Werte, Skizzen und auch Vorbereitungsaufgaben. Diese reichen von „lest die Texte“ bis „berechnet die Maschinenleistung“. Der Zweck besteht darin, schon einmal das Wissen aus der Vorlesung wieder herauszukramen. Und auch das Mindset wird auf das Fertigungsverfahren eingepegelt. Im Labor gibt es dann noch eine kurze raum- und versuchsbezogene Sicherheitsunterweisung. Es folgen ein Gespräch, um die Vorbereitung abzugleichen und die Aufgabe zu klären, und vielleicht noch ein kleiner Theorieteil. Dann geht es schon an die Versuchsvorbereitung. Die Proben oder Rohteile werden entgratet und gemessen. Tabellen erstellt und Maschinen gestartet und warmgefahren. Dann werden Formen vorbereitet, Abgüsse erstellt, Teile zerspant und Bleche gezogen. Dabei werden häufig mit rechnergestützten Messketten noch Daten erhoben, Diagramme erstellt und ausgewertet. Nach dem Versuch wird meist von den Studierenden noch ein Laborprotokoll geschrieben. Dazu gibt es eine eigene Podcastepisode.
Aber wozu treiben wir den ganzen Aufwand eigentlich? Es gibt Stimmen, die behaupten, dass Animationen, Simulationen und Videos in der Vorlesung doch ausreichen würden. Wozu gibt es denn die virtuelle Werkzeugmaschine? Pressen sind groß und teuer und die Laborgruppen mit 14 Personen müssen auch in kleinere Einheiten unterteilt werden. Abgesehen vom Betreuungsaufwand.
Dabei erinnere ich mich gerne an den Besuch einer Grundschulklasse bei uns im Institut. Die Lehrerin schickte die Schülerinnen und Schüler mit geschlossenen Augen in die Werkstatt und fragte nach den Eindrücken. „Es riecht komisch.“ „Es hallt.“ „Es laufen Motoren.“ „Der Boden ist anders.“
Das alles sind Eindrücke, die bei Shorts oder Reels verloren gehen. Bröckel- oder Wirrspäne kann man ganz vorsichtig auch mal anfassen. Das Rattern, das sich in den Rattermarken niederschlägt kann man nicht nur hören sondern beim Handauflegen auf die Maschine auch spüren. Und man merkt, wie es verschwindet, wenn man Vorschub oder Drehzahl ändert.
Als ich von einem Unternehmen mal eine Maschine für die Lehre übernommen habe, war ich für zwei Tage im Werk. Ich wollte lernen, wie die Maschine klingt, wenn Sie richtig gut läuft. Wie ölig feucht muss die Linearführung der Presse schimmern, wenn alles stimmt. Wann ist sie zu trocken. Wie klingt es, wenn etwas schief geht.
Die Notwendigkeit von Gehörschutz in der Werkstatt versteht man nur dann, wenn man ihn selbst mal aufsetzen wollte, wenn die Probe geschmiedet wird.
Auch wenn das Bild schon etwas abgenutzt ist: Wir wollen, dass die Student:innen Fertigungstechnik „begreifen“. Wenn man vor dem Abguss vergessen hat, den Kern einzulegen, dann ist das eine Erfahrung, die bleibt. Die freudiger Erwartung beim Öffnen der Form, ob Bläschen im Abguss sind. Den beschriebenen und berechneten Bodenreißer selbst zu hören und aus dem Tiefziehwerkzeug zu holen, ist besonders. Pulver ins Werkzeug zu schütten und nach dem Pressvorgang einen mehr oder weniger stabilen, metallisch blanken Grünling in der Hand zu halten (und auch mal mit der Hand zu zerbrechen) ist immer wieder beeindruckend.
Das kann kein Video ersetzen. Im Gegenzug dazu ersetzen die Laborübungen natürlich auch keinen Gesellen- oder Facharbeiterbrief.
Ich habe noch in keiner Vorlesung so leuchtende Augen gesehen, wie in der Laborübung, in der die Student:innen einen Zweitaktmotor mit Getriebe auseinandergenommen haben. Zitat 1: „Da sind ja tatsächlich ZWEI Kugellager verbaut und mit Wellensicherungsringen fixiert.“ Zitat 2: „So habe ich mir ein Maschinenbaustudium immer vorgestellt!“.
Ja, Produktionsmaschinen sind teuer und die Labore sind aufwändig. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Die Studierenden können diese Erfahrungen im Berufsleben wirklich brauchen. Wie ist Eure Meinung? Schreibt es uns in die Kommentare oder per Mail.
Ach übrigens: Wir haben tatsächlich einen Laborraum mit gekachelten Wänden: Darin steht die Funkenerosionsanlage. Und einige Kollegen haben auch Kittel. Allerdings sind die grau oder blau.
geschrieben von Benjamin Remmers
eingesprochen von Benjamin Remmers